
Sie sind noch kein Fidelity Kunde?
Eröffnen Sie zunächst ein FondsdepotPlus. Danach können Sie aus unseren Fonds und ETFs Ihre Favoriten wählen.
Sie sind bereits Fidelity Kunde?
Melden Sie sich in Ihrem Depot an, um Fondsanteile zu ordern oder Ihren Sparplan anzulegen oder anzupassen.
Themen & Märkte
Themen im Fokus
Veranstaltungen & Web-Seminare
Veranstaltungen & Web-Seminare
Finanzwissen für Privatanleger Web-Seminare für Professionelle Anleger
Wissen
Anlageziele bestimmen
Anlageziele bestimmen
Die eigene Lage analysieren Bestandsaufnahme Geldanlage nach Lebensphasen Mit Risiken umgehen
Portfolio ausbauen
Geldanlage mit Fonds umsetzen
Geldanlage mit Fonds umsetzen
Ein Depot managen Fonds & ETFs Vermögensverwaltung Sparplan
Werkzeuge für Anlageerfolg nutzen
Über uns
Fidelity International
Fidelity International
Unternehmen Nachhaltigkeit Presse Karriere bei Fidelity Das Fidelity Team
Professionelle Anleger
Vertriebspartner
Vertriebspartner
Übersicht Fonds Im Fokus Web-Seminare Fondspreise & Wertentwicklung My Fidelity
Institutionelle Anleger
Institutionelle Anleger
Übersicht Anlagestrategien Anlagethemen Insurance Solutions Klimawandel und Biodiversität
Betriebliche Vorsorge
Betriebliche Vorsorge
Übersicht bAV News FondsPensionsplan Zeitwertkonten Kapitalanlage Insolvenzsicherung Globale Vorsorgestudien
Themen & Lösungen
Home Fidelity Articles Themen im Fokus
Europas Rolle in der neuen Geoökonomie

Carsten Roemheld - Kapitalmarktstratege Fidelity International
13. Juni 2022
Ein Blick auf die Weltkarte reicht aus, um zu erkennen: Die Europäische Union steht weltweit vor immensen wirtschaftlichen Herausforderungen. Katrin Kamin vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel erklärt im Kapitalmarkt-Podcast, warum auf einmal so viel über Geoökonomie gesprochen wird. Wieso „Wandel durch Handel“ keine Zukunft mehr hat. Was Deutschlands Energiereserven damit zu tun haben. Und warum wir unseren Blick verstärkt nach Indien richten sollten.
Deutschland, die EU und die Supermächte (I): „Wandel durch Handel“ stößt an Grenzen
Deutschland und die Europäische Union befinden sich in einer herausfordernden Gemengelage. Im Kapitalmarkt-Podcast spricht die Welthandelsexpertin Katrin Kamin über die neue Rolle der Geoökonomie nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Sie erklärt, wie die Zusammenarbeit mit Handelsmächten wie Russland und China künftig aussehen kann. Und warum das Konzept „Wandel durch Handel“ gescheitert ist.
Deutschland, die EU und die Supermächte (II): Die neue Machtverteilung fordert Europas Zusammenhalt
China hat sich in den vergangenen Jahren zu einem äußerst versierten wirtschaftlichen Player entwickelt. Eine Integration der Supermacht in die westliche Wirtschaft ist aber nicht gelungen. Katrin Kamin, Expertin für Geoökonomie, erklärt, warum sie nicht an eine neue Blockbildung zwischen Ost und West glaubt. Im Kapitalmarkt-Podcast spricht sie zudem über die möglichen Antworten der EU und Deutschlands auf die veränderte wirtschaftliche Weltkarte. Und sagt, welche Rolle Deutschlands Energiereserven in Zukunft spielen werden.
Transkript zum Podcast — Teil 1
Carsten Roemheld: Die Europäische Union gibt sich ungewohnt entschlossen in ihren Reaktionen auf Putins Krieg und sie handelt durchaus geschlossen. Doch wie lange wird der Burgfrieden bestehen? Könnten nationale Interessen dem gemeinsamen europäischen Handel entgegenstehen? Oder besinnt sich die EU gerade auf ihre Stärke als gemeinschaftlicher Wirtschaftsraum? Was bedeutet das für die gemeinsame Sicherheits-, Energie- und Agrarpolitik? Und wie findet Deutschland in Europa seine neue wirtschaftliche Rolle?
Das alles sind Fragen von großer geopolitischer und geoökonomischer Bedeutung. Genau zu diesen beiden Themen forscht meine heutige Gesprächspartnerin Frau Dr. Katrin Kamin vom Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel. Sie ist stellvertretende Leiterin des Forschungszentrums für Handelspolitik am IfW und zudem als Mitglied einer ‚Trade Policy Task Force‘ des IfW-Präsidenten aktiv. Im vergangenen November, wenige Monate vor dem Kriegsausbruch, erschien eine Studie über „Instruments of a strategic foreign economic policy“ im Auftrag des neuen Außenministeriums, an der sie federführend mitgeschrieben hat. Das Handelsblatt beschrieb das Papier als eine Art Handbuch der Geoökonomie für das Auswärtige Amt.
Genau darüber wollen wir heute sprechen und über die Frage, wie wir uns einstellen können auf die neue Weltlage. Eines ist schließlich offensichtlich wie nie: Staaten wie Russland oder auch China nutzen inzwischen gezielt die ökonomische Abhängigkeit anderer Staaten, um eigene politische Interessen durchzusetzen. Zugleich hat die EU und nicht zuletzt Deutschland ein besonders großes Interesse an einem offenen Welthandel mit klaren Regeln und verlässlichen Partnern. Wie passt das zusammen?
Heute ist Dienstag, der 31. Mai 2022, mein Name ist Carsten Roemheld, ich bin Kapitalmarkt-Stratege bei Fidelity International und ich freue mich sehr auf die kommenden 45 Minuten mit Katrin Kamin.
Herzlich willkommen beim Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity, Frau Kamin.
Katrin Kamin: Hallo, danke schön, vielen Dank.
Carsten Roemheld: Geoökonomie ist das Stichwort, Frau Kamin. Ein Begriff, der in letzter Zeit immer öfter zu hören ist. Doch was ist damit eigentlich gemeint und warum sprechen auf einmal alle darüber?
Katrin Kamin: Ja, mit dem Begriff ‚Geoökonomie‘ ist gemeint, dass Staaten vermehrt in den letzten 10, vielleicht auch 20 Jahren – das kommt so ein bisschen drauf an, worauf man guckt – anfangen, ökonomische Mittel zu verwenden, um Zwang zu erzeugen, um andere Staaten zu Dingen zu zwingen. Da geht‘s häufig um außenpolitische Ziele. Und das ist nicht neu, dass Staaten das tun. Das sehen wir durch die Geschichte hinweg. Es gibt ganz viele Beispiele für Embargos, für Sanktionen, auch schon vor 100, vor 200 Jahren, wo genau das gemacht wurde.
Aber wir haben eine vor allem in den letzten 30 Jahren veränderte Weltsituation. Wir haben den Aufstieg von China gehabt, wir haben eine starke Globalisierung gehabt, die dann nach der Finanzkrise ein bisschen sozusagen einen leichten Ditsch gekriegt hat und seitdem stagniert. Also wir sehen keine Deglobalisierung tatsächlich, wenn wir uns das angucken, aber man sieht schon sehr deutlich, dass sie stagniert. Und dennoch haben wir natürlich eine wachsende Anzahl an Interdependenzen, also wir haben eine sehr tiefe Verflechtung über ‚Global Value Chains‘ und ‚Supply Chains‘ und das schafft natürlich auch Verwundbarkeiten. Und diese Verwundbarkeiten werden eben zunehmend genutzt.
Eine weitere Entwicklung, die wir auch beobachtet haben in den letzten 20 bis 30 Jahren und die da auch mit reinspielt, ist, dass es immer weniger zwischenstaatliche Konflikte gibt. Also das, was wir jetzt gerade beobachten, so ein Konflikt oder so ein Krieg, wie wir ihn jetzt gerade beobachten, die Anzahl dieser Kriege hat ganz stark abgenommen und das hat natürlich auch damit zu tun, dass solche Kriege sehr teuer sind. Aber das hat auch damit zu tun, dass eben diese wirtschaftlichen Mittel stärker genutzt werden können, um andere Staaten zu erpressen. Das sind die Entwicklungen, die alle parallel liefen und die Geoökonomie dann am Ende bedingt haben und dazu gebracht haben, dass sie jetzt so groß ist und so wichtig ist.
Und somit haben wir so eine Art Shift gesehen von einer liberalen globalen Wirtschaftsordnung seit den 50er Jahren, die aber geprägt war von ökonomischen Regeln, und jetzt sehen wir irgendwie stärker, dass die Außenpolitik die Ökonomie übernimmt und da stärker mit reinspielt.
Carsten Roemheld: Sie haben den Krieg ja angesprochen. Der schreckliche Krieg in der Ukraine dominiert immer noch die Schlagzeilen und das Vorgehen Putins sorgt eben für Fassungslosigkeit und für Entsetzen. Der Westen hat reagiert, unter anderem mit einem Bündel von Handels- und Finanzsanktionen. Können Sie kurz erklären, wie diese Sanktionen oder dieses Sanktionspaket wirken sollen?
Katrin Kamin: Ja, es sind ja mehrere Sanktionspakete und die bauen aufeinander auf. Und am Anfang hat man meiner Einschätzung nach gehofft, dass man mit einer schnellen Reaktion Putin vielleicht schon zum Einlenken bewegen kann. Da hat man sich dann eben getäuscht, das hat nicht funktioniert. Ich denke, Europa wurde sehr überrascht von dem Krieg und das spiegelt sich auch ein bisschen in den Sanktionsmaßnahmen wider. Und was sich eben auch widerspiegelt, ist, dass Europa da leider oder die EU da leider nicht immer geschlossen dasteht und dass eben dann die nationalen wirtschaftlichen Interessen oft eine Rolle spielen und das Ganze torpedieren.
Aber insgesamt sollen die Sanktionen natürlich eigentlich so wirken, dass sie den Staat wirtschaftlich schwächen und, ich glaube, es war nie das Ziel oder es wäre ein unrealistisches Ziel, zu sagen, man bewegt Putin zur Aufgabe, aber zumindest zu Verhandlungen ihn zu zwingen. Und das ist natürlich schwierig immer einzuschätzen, ob das dann tatsächlich auch funktioniert, vieles davon findet hinter verschlossenen Türen statt.
Carsten Roemheld: Das wollte ich gerade fragen: Welche Aussicht haben wir denn? Es sieht ja so aus, als hätte sich Russland zumindest sehr gut vorbereitet auf diesen Krieg, auch finanziell und bilanziell. Im Moment scheint es ja nicht so die Wirkung zu entfalten.
Katrin Kamin: Ja, genau, das ist tatsächlich so, dass Russland sich sehr gut vorbereitet hat; fiskalisch zumindest. Aber wir sehen jetzt schon, dass die Importe nach Russland ganz stark einbrechen. Also realwirtschaftlich hat das große Konsequenzen für Russland und es sind so ein bisschen gegenteilige Effekte. Auch die Finanzsanktionen spielen ja eine große Rolle und dann werden teilweise Banken sanktioniert und teilweise nicht und das ist sehr, sehr komplex und sehr, sehr schwierig, nachzuvollziehen, welche Effekte dann da tatsächlich wirken, wie sie wirken und was am Ende da sozusagen unterm Strich bei rauskommt. Das wäre auch zu viel „Glaskugel“, wenn ich da jetzt sagen würde, das können wir erwarten und das nicht.
Carsten Roemheld: Jetzt sind ja diese Energiesanktionen, die im Raum stehen, wahrscheinlich mit das schärfste Schwert gegen Putin. Die EU hat einen 300-Milliarden-Euro-Plan vorgestellt, um sich da langsam zu lösen von den fossilen Brennstoffen aus Russland. Glauben Sie, dass das gelingen kann, also dieses Ablösen von Russland oder, dass auch das Sanktionspaket überhaupt durchgesetzt wird?
Katrin Kamin: Ob das Sanktionspaket durchgesetzt wird, weiß ich nicht. Da stecke ich zu wenig drin. Aber ich glaube schon, dass man sich temporär von Russland lösen kann. Also ich glaube, man muss betrachten, wir werden irgendwann wieder mit Russland handeln. Das steht, glaube ich, außer Frage, aber temporär könnten wir uns lösen auf jeden Fall.
Das haben auch viele Studien, auch wirtschaftswissenschaftliche Studien gezeigt. Und ich denke, das ist eine Option, die eigentlich vielleicht auch noch stärker gefordert werden sollte. Aber auch hier spielen wieder nationale Interessen – wir haben es gerade dieser Tage gesehen – eine große Rolle und führen dann eben zu Uneinigkeit in der EU und dann auch zu Handlungsunfähigkeit. Und das ist ein großes Problem.
Carsten Roemheld: Die Debatte zeigt auf jeden Fall eindrücklich, was es für den Welthandel und für unseren Wohlstand bedeuten kann, wenn Staaten immer stärker die ökonomischen Mittel einsetzen, um eben außenpolitische und wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Ein anderes Beispiel sind die Schlagzeilen rund um den Weizen: Russland blockiert die Seehäfen der Ukraine und soll zudem auch Getreide aus eroberten Städten stehlen; und im Westen wächst die Sorge vor einer Welthungerkatastrophe. Erleben wir gerade die Schattenseiten der Globalisierung, weil wir uns in zu große geoökonomische Abhängigkeiten begeben haben und damit erst möglich gemacht haben, dass Zugang zu bestimmten Gütern auf einmal zur Waffe wird?
Katrin Kamin: Ja, das haben Sie gut beschrieben. Ich glaube schon, dass vor allem auch in Deutschland uns das jetzt sehr auf die Füße gefallen ist, unsere starke Rohstoffabhängigkeit gegenüber Russland. Und die Weizenproblematik, die Sie jetzt angesprochen haben, ist ja noch mal sozusagen auch die Kehrseite der Medaille. Die hat jetzt ursächlich eigentlich erst mal nichts mit dem Konflikt zu tun und ist dann natürlich nachgelagert, aber natürlich schon, weil zum einen nicht nur Russland sozusagen den Export verhindert, sondern auch in der Ukraine die Bauern gar nicht mehr den Weizen überhaupt wegtransportiert bekommen. Also der Krieg hat eine direkte Auswirkung auf den Weizenhandel und dann eben noch mal Russland, die das sozusagen auch als Druckmittel verwenden.
Und ja, man kann schon sagen, es wird auf jeden Fall die Aufgabe sein, in der Zukunft sich zu überlegen, wie abhängig wollen wir sein von bestimmten Staaten. Und die Balance ist aber eben eine sehr schwierige. Sie haben selber gesagt, Deutschland ist ein Exportland. Gerade in Deutschland und auch für die EU ist Außenhandel wichtig und Grundlage des Wohlstandes. Und das bedeutet, diese Balance zu finden zwischen: Mit wem handeln wir, wie abhängig machen wir uns und wir wollen aber Multilateralismus stärken. Das ist sozusagen die Gretchenfrage und das große Thema.
Carsten Roemheld: Genau das wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen: die veränderte wirtschaftliche und politische Landkarte und auch ein bisschen die Machtverhältnisse vielleicht sortieren. Wir haben es gerade schon mehrfach angesprochen, kommen wir zur Globalisierung noch mal zurück. Deutschland und Europa haben ja wirklich stark profitiert vom freien Handel mit Rohstoffen, mit Waren, vom freien Kapitalverkehr, von der weltweiten Vernetzung. Jetzt sind wir umgekehrt mit den vielen Abhängigkeiten auch besonders verletzlich. Haben wir denn aus Ihrer Sicht schon eine neue Strategie, wie wir dieses Szenario in Zukunft angehen wollen?
Katrin Kamin: Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen Deutschland und der EU. Also die EU hat „schon“ 2019 mit der Ausrufung einer ‚geopolitischen Kommission‘ durch Ursula von der Leyen da schon mal ein sehr deutliches Zeichen gesetzt und auch die neue Außenhandelsstrategie ist eher von diesem geopolitischen Framework geprägt, wo es ja auch viel um diese offene strategische Autonomie geht.
In Deutschland sieht das anders aus. Also ich bin leider sehr pessimistisch, was Deutschland angeht. Da sehe ich keine Vorbereitung oder kein Vorbereitetsein auf die Situation, in der wir jetzt waren, und das kann man an unterschiedlichen Dingen sehen. Das sieht man natürlich zum einen an der Rohstoffabhängigkeit, über die wir gerade schon gesprochen haben. Dass wir überrascht wurden und auch überfordert sind, sieht man aber zum Beispiel auch an so Dingen wie dem Zustand der Bundeswehr. Also ich meine, wenn man jetzt mal ganz klar auch auf den sicherheitspolitischen Sektor guckt, sind wir da nicht besonders vorbereitet und strategisch vorbereitet gewesen.
Woran kann man es noch erkennen, wenn man sich jetzt unsere wirtschaftliche Vernetzung anguckt? Man erkennt es daran, dass wir eben sehr stark abhängig sind von Schwellenländern. Wir haben wie kein anderes oder wie wenig andere Länder stark in Schwellenländer investiert und sind damit dann auch abhängig von den Veränderungen in diesen Schwellenländern, seien die wirtschaftlich oder politisch.
Fossile Ressourcen haben wir schon angesprochen. Auch da sind wir sehr abhängig und wir sichern oft unsere Rohstoffversorgung durch Zukäufe und nicht durch Investitionen. Das ist im Rohstoffsektor so, das ist aber auch im Bereich der Zwischenprodukte so, also gerade dann, wenn wir uns Halbleiter angucken, die ja gerade so als das wichtigste strategische Zwischenprodukt gelten, auch die kaufen wir zu.
Und das andere: Also wir könnten da mehr investieren, Investitionen wäre ein Punkt, aber das haben wir bisher nicht gemacht. Das andere ist die Sicherung von Handelswegen. Also auch da geht es eben nicht darum, dass wir dafür sorgen, dass Piraterie uns keine Probleme macht, sondern es geht auch darum, zu gucken, welche strategischen Knotenpunkte müssen wir sichern und welche Häfen oder welche Flughäfen – wie sind wir infrastrukturell da aufgestellt?
Und ein weiteres Thema ist zum Beispiel auch ‚deutsche Investitionen in China‘. Wie viel investieren wir in Ländern? Das ist ja jetzt auch gerade eine große Debatte in der Industrie: Wie viel investieren wir da, wie stark gehen wir da rein und was machen wir, wenn wir da jetzt erst mal drin sind? Und wie kommen wir aus der Nummer im Zweifel wieder raus?
Exportorientierung, genau: Für uns ist es deswegen so wichtig eigentlich, müsste man meinen, sich gut Gedanken zu machen. Wie wird strategisch investiert? Wie betreiben wir strategischen Handel? Und das ist jetzt sozusagen ‚overdue‘, also es muss jetzt passieren. Und ich sehe, es gibt jetzt Ansätze sozusagen. Also die Debatte nimmt jetzt Fahrt auf, aber ich würde sagen, wir sind eigentlich schon einen Ticken zu spät dran; gerade, wenn man sich das Engagement von China und so anguckt.
Carsten Roemheld: Und Sie haben es ja auch gesagt: Resilienz ist auch ein wichtiges Stichwort, dass wir in dem Bereich natürlich mehr tun. Ich fand besonders spannend Ihre Ausführungen zum Thema ‚Kaufen versus Investieren‘. Da machen andere Länder das vielleicht deutlich besser insgesamt. Sie hatten auch schon mal über USA und China gesprochen. Die beiden großen Machtblöcke ringen ja nach wie vor um die wirtschaftliche und politische Vorherrschaft in der Welt und dieser Konflikt wird ja auch und nicht zuletzt mit den von Ihnen beschriebenen geoökonomischen Instrumenten ausgetragen. Was bedeutet das denn für die Europäer? Können wir davon profitieren, wenn sich Chinesen und Amerikaner gegenseitig mit Sanktionen und Zöllen das Leben schwer machen oder ist das für uns am Ende auch ein Schaden?
Katrin Kamin: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Die Wissenschaftler sagen dann immer: „it depends“. Also was wir sehen bei Sanktionen wie auch bei Zöllen wie zum Beispiel in dem Handelskrieg zwischen den USA und China, es kommt eigentlich immer zum Handelsumlenkungseffekten. Das heißt, wenn jetzt angenommen die USA einen Strafzoll erheben gegenüber Stahlprodukten oder Stahlimporten aus China, dann kann das positive Auswirkungen haben auf die europäische Industrie, weil die Amerikaner dann mehr Stahlprodukte aus der EU importieren. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber es kann auch genauso anders sein, ja. Es kann genauso sein, dass Sektoren, weil wir bestimmte Zwischenprodukte liefern, die dann nicht mehr geliefert werden können oder nicht mehr nachgefragt werden, dass dann Sektoren davon negativ betroffen sind. Das kommt immer sehr stark darauf an, wo, in welchen Sektoren finden die Zölle statt und genauso auch die Sanktionen.
Wir haben eine Studie gemacht vor zwei Jahren, da haben wir uns eben auch angeguckt, was für Wohlfahrtseffekte und was für Preiseeffekte bestimmte Szenarien, wenn sich da der Handelskonflikt verschärft oder abmildert, haben. Und wir konnten schon sehen, dass das zunächst erst mal bei protektionistischen Maßnahmen zwischen zwei Ländern, also auf bilateraler Ebene zwischen den USA und China, durchaus auch erst mal einen positiven Effekt haben kann in der Mittel- und Langfrist für Europa. Aber das war nur ein Ergebnis und das kommt dann immer sehr auf die Annahmen drauf an und darauf, was man sich anguckt, welche Sektoren betroffen sind. Und was eben auch häufig passiert in solchen Konstellationen, ist, dass das ganz seltsame Auswüchse hat. Es gab diesen Fall, die USA haben in dem Handelskrieg dann plötzlich Kekswaren, irgendwelche Confiseriehersteller sanktioniert. Also das bekommt dann manchmal ganz seltsame Auswüchse und es werden Industrien getroffen, mit denen man gar nicht gerechnet hätte.
Carsten Roemheld: Wir hatten vorhin schon mal die Handelswege angesprochen. Wie steht denn Europa da mit Blick auf die offenen Handelswege? Welche Rolle spielt die Ostsee und die Mittelmeerregion? Wie sehen Sie Europa hier positioniert?
Katrin Kamin: Die Ostsee bekommt jetzt gerade natürlich eine neue Bedeutung mit dem Krieg und den Ostseeanrainerstaaten – ist ja klar. Aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil, soweit ich weiß, jetzt in Zukunft auch mehr Flüssiggas über die Ostsee, dann über den Nord-Ostsee-Kanal hier in Kiel vorbei aus Norwegen Richtung der LNG-Terminals transportiert werden soll. Also da wird die Ostsee sicherlich noch mal eine neue Bedeutung bekommen, aber, ich denke, gerade die strategische Bedeutung hier mit dem Baltikum und auch Russland als Ostseeanrainer, da wird die Ostseeregion wieder interessant und aufgewertet werden; zumindest, was die strategische Wichtigkeit angeht.
Beim Mittelmeer sagen wir immer: Eigentlich muss sich Europa stärker um seine Nachbarn im Süden kümmern und sollte da auch mehr investieren in die ökonomische und politische Stabilisierung der Mittelmeeranrainer und das aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, weil wir ja nun durch die Dekarbonisierung einfach auch wahrscheinlich Nettoimporteur von Grünem Strom werden und wir noch nicht genau wissen, wo kann der herkommen. Eine Möglichkeit wäre eben zum Beispiel die Solarstromerzeugung im Mittelmeerraum. Das ist ein wichtiger Punkt. Und der andere Punkt, den haben Sie angesprochen, sind natürlich die Handelsrouten. Und wir sehen ja zunehmendes chinesisches Engagement, auch durch diese maritime Seidenstraße im Mittelmeerraum. Piräus, ich glaube der Hafen, der ist zum Großteil schon durch chinesisches Investment abgedeckt. Und wenn man sich das mal anguckt, da denke ich, muss Europa sehr vorsichtig sein.
Also ich hatte es vorhin schon angesprochen: Gerade diese Sicherung der Handelswege und von strategischen Knotenpunkten ist immens wichtig. Wir haben ein Beispiel aus Hamburg tatsächlich, wo es ja ein Investment geben soll von der chinesischen Firma COSCO. Und es ist auch eben ein Staatsunternehmen und da geht es nur um ein relativ geringes Investment, also jetzt nicht über 50 %, ich meine, es liegt bei 35 %, in dem Containerterminal Tollerort. Aber wenn man dann mal rauszoomt und sich die komplette Europakarte anguckt und guckt, wo China schon überall - oder chinesische Unternehmen und auch chinesische Staatsunternehmen - schon überall investiert haben, dann beginnt man zu begreifen, dass es eben nicht nur ein Investment in Deutschland ist, sondern man muss das Ganze sehr stark von europäischer Seite aus betrachten. Und da ist, denke ich, auch noch mal mehr Kommunikation zwischen den Nationalstaaten, der EU-Mitgliedsstaaten und der EU-Ebene, notwendig, um da besser Antworten zu koordinieren.
Carsten Roemheld: Gerade bei dieser Neue-Seidenstraßen-Initiative wollte ich noch mal ein bisschen nachfragen, weil es ja schon ein gigantisches Projekt ist und die weltweiten Handelswege sicherlich noch mal neu definiert werden dadurch. Erste Frage: Ist das Projekt nach wie vor mit der gleichen Energie im Gange, wie es am Anfang war? Ich habe den Eindruck, es hat sich so ein bisschen reduziert, auch von den finanziellen Möglichkeiten Chinas her. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht können Sie es beantworten. Und die zweite Frage: Wie sehr wird das denn den Welthandel prägen?
Katrin Kamin: Ja, also ich denke, das wird den Welthandel sehr prägen. Das tut es auch schon. Das hat damit zu tun, dass China ein sehr versierter geoökonomischer Player ist. Die haben durchaus sehr, sehr stark angefangen, auch mit dem Investment und Engagement in Afrika und da wahnsinnig viele Infrastrukturprojekte gebaut und investiert. Und diese Infrastrukturprojekte sind teilweise sehr oder sind zum Großteil sehr nebulös. Also die Verträge sind sehr nebulös, sie sind oft an politische Konditionen geknüpft, es wird eine Umschuldung ausgeschlossen. Da wird schon sehr deutlich, wie strategisch die Investments hier sind.
Ähnlich auch diese maritime Seidenstraße, die eben dann ja auch Europa umspannt. Das wird den Welthandel prägen und China tut es auch schon. Gerade was den Waren-/Güterhandel angeht, ist China ja schon sehr stark. Und wenn man sich anguckt, wie China in den letzten 20 Jahren aufgeholt hat, da hatten wir, der Westen, auch gehofft, China einhegen zu können, integrieren zu können durch Handel. Auch da dieses Wandel-durch-Handel-Dogma. Man hatte den Eindruck nach dem Zerfall der Sowjetunion „Okay, das hat funktioniert, jetzt machen wir das mit China auch“ und wir sehen aber, das stößt jetzt hier an seine Grenzen, das funktioniert so nicht.
Ich bin immer vorsichtig damit, zu sagen, dass wir jetzt eine Blockbildung erleben. Da würde ich noch ein bisschen abwarten, ob das tatsächlich stattfindet. Denn genauso abhängig, wie wir von China sind, ist China auch abhängig von uns. Europa ist immer noch eine Handelsmacht und wird es gemeinsam mit den USA auch noch eine ganze Zeit lang bleiben. Aber es ist sozusagen Vorsicht geboten.
Carsten Roemheld: Es ist also eine herausfordernde Gemengelage vor der Deutschland, aber auch die EU insgesamt gerade steht. Frau Kamin, ich danke Ihnen schon einmal herzlich für Ihre Einordnung zur Rolle der geopolitischen Wirtschaft im Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bis hierher.
Im zweiten Teil unseres Podcasts werden wir dann noch vertiefen, wie Deutschland und die EU mit diesen Herausforderungen am besten umgehen. Außerdem sprechen wir darüber, warum gerade Indien in der geoökonomischen Strategie Deutschlands eine so wichtige Rolle spielt. Und wir klären, was es eigentlich mit dem ‚Klimaklub‘ auf sich hat. Hören Sie rein!
Ihr Carsten Roemheld
Transkript zum Podcast — Teil 2
Carsten Roemheld: Das Konzept ‚Wandel durch Handel‘ stößt in der Zusammenarbeit mit China an seine Grenzen, das sagt Katrin Kamin vom Forschungszentrum für Trade Policy am Kieler Institut für Weltwirtschaft. China hat sich in den vergangenen Jahren zum versierten ökonomischen Player entwickelt, eine Integration der Supermacht in die westliche Wirtschaft ist dabei aber nur teilweise gelungen. Im ersten Teil unseres Gesprächs hat Katrin Kamin erklärt, warum sie nicht an eine neue Blockbildung glaubt. Ihre These: China ist genauso abhängig von den USA und der EU wie wir von China. Dennoch ist Vorsicht geboten.
Im zweiten Teil unseres Gesprächs reden wir darüber. Wir klären die möglichen Antworten der EU und Deutschlands auf die neue geoökonomische Lage und wir sprechen darüber, welche Rolle Deutschlands Energiereserven in Zukunft spielen werden, und diskutieren die Rolle der World Trade Organization.
Willkommen zurück im zweiten Teil meines Podcasts mit Katrin Kamin.
Wenn man das alles so hört, muss man sich ja wirklich neu definieren. Und wir müssen uns vielleicht auch die Frage stellen in der EU – Sie hatten jetzt von Deutschland schon gesprochen - aber in der EU – wie man darauf antworten kann auf die neue Situation. Eine Antwort könnte ja sein, dass man den Binnenmarkt weiter stärkt und das vertieft. Sie sprechen gerne hier von dem sogenannten ‚Brussels effect‘ oder dem Brüssel-Effekt. Was genau bedeutet das? Was ist das und was bringt uns dieser Effekt?
Katrin Kamin: Man muss hier unterscheiden: Der ‚Brussels effect‘ beschreibt, dass Länder, die jetzt erst mal nicht mit der EU in Verbindung stehen durch ein Freihandelsabkommen oder so, trotzdem Standards und Normen übernehmen, Regulationen übernehmen und sozusagen die Normen und Standards der EU ausstrahlen über die EU hinaus und auch über Partner hinaus. Das ist jetzt eine sehr verkürzte Darstellung, es gibt sehr viele Aspekte dieses „Brussels effects“.
Und der Binnenmarkt hängt insofern damit zusammen, dass es darum geht, dass die anderen Länder gerne Teil des Binnenmarkts sein wollen oder mit dem Binnenmarkt handeln wollen. Also die Attraktivität des Binnenmarktes spielt da die Rolle. Und wenn ein Land sagt: „Okay, ich will unbedingt etwas in die EU exportieren oder mit der EU auf irgendeine andere Art und Weise Handel treiben. Mir ist das so wichtig, dass ich die Standards übernehme, damit ich das kann.“ Dafür spielt eben die Attraktivität des Binnenmarktes eine Rolle.
Und wir haben sehr leidvoll gesehen, dass Vorteile des Binnenmarktes verspielt werden in der Pandemie; dadurch, dass zum Beispiel dann nationale Interessen hochkommen und man protektionistische Maßnahmen ergreift. Das war sehr schwierig, das zu beobachten für Handelsökonomen. Aber wir sehen eben auch die Vorteile des Binnenmarktes. Wir haben uns mal angeguckt, wo wir abhängig sind, wo die EU abhängig ist von sehr wenigen Lieferanten, von sehr wenigen Lieferländern. Und da sieht man sehr deutlich, dass die EU sehr viele Produkte eben aus einer großen Anzahl von Ländern bekommt und vor allem eben auch bewusst groß- und größtenteils aus dem Binnenmarkt. Also der Binnenmarkt ist schon für die EU-Länder, die EU-Mitgliedsstaaten, sehr, sehr wichtig. Und diese Vorteile gilt es zum einen zu erhalten und zum anderen eben auch auszubauen, damit man weiterhin auch als Handelspartner attraktiv bleibt. Das ist das, was dahintersteckt.
Carsten Roemheld: Beim Brexit hat es ja nicht so funktioniert, dass sie ja genau aus dieser Systematik eigentlich ausscheiden wollten. Insofern sehr, sehr schade natürlich im Rückblick. Aber das war halt ein Beispiel, wo eben da diese Normen nicht unbedingt anerkannt wurden oder wo sie eher dazu geführt haben, dass die Briten ausgestiegen sind. Aber aus welcher Perspektive oder in welchen Politikfeldern lässt sich denn auf der EU-Ebene durch den Brüssel-Effekt besonders viel erreichen und wo aus Ihrer Sicht nur wenig?
Katrin Kamin: Ja, das ist eine heikle Frage und nur schwierig zu beantworten. Also was man gesehen hat, ist, dass das im Bereich der Datenschutzgrundverordnung super funktioniert oder scheinbar super funktioniert hat. Denn ein Problem ist, dass man den ‚Brussels effect‘ nicht besonders gut messen kann. Das heißt, es ist ein Bereich, also es ist etwas, was ja von einer Juristin, von Anu Bradford, aufgeschrieben wurde, die sich das über ‚regulations und rules‘ angeguckt hat. Aber das wurde dann sehr stark übernommen, so in diesem Policy-Bereich, aber tatsächlich gibt es wenig Studien, die das sozusagen quantitativ belegen, dass es diesen ‚Brussels effect‘ tatsächlich gibt. Denn eine Frage, die sich da zwangsläufig stellt, ist: Wie messen wir Normen und wie messen wir Standards? Und das ist wahnsinnig schwer, da an Daten zu kommen, sage ich aus eigener Erfahrung.
Und deswegen in dem Bereich der Datenschutzgrundverordnung: Da konnte man sehen, dass, ich glaube allein in den Jahren 2010 bis 2020, weltweit 66 sehr ähnliche quasi an die Datenschutzgrundverordnung angelehnte Datenschutzverordnungen implementiert wurden. Und das ist so was, da kann man wahrscheinlich, wenn man juristisch da reingeht und sich anguckt: okay, wie ist das aufgebaut oder wie ähneln die sich, kann man da wahrscheinlich schon einen Effekt sehen.
Ich würde sagen, dass ein Großteil des ‚Brussels effects‘ eben vor allem auch der Handelseffekt ist, den wir haben, wenn wir Freihandelsabkommen oder Handelsabkommen schließen mit anderen Staaten. Und die Attraktivität des Binnenmarkts ist dafür zentral. Also wir müssen dafür sorgen – und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch –, dass es attraktiv ist, mit uns Handel zu treiben.
Und ein wichtiger Punkt, den ich gerade neulich auch in einer anderen Diskussion dazu hatte, ist eben auch: Wie gestalten wir unsere Demokratie? Wie können wir unsere Demokratie resilienter machen? Und das ist vor allem vor dem Hintergrund wichtig, Sie haben es gerade gesagt: Wir erleben einen erstarkenden Populismus, wir erleben ein Erstarken der Autokratisierung. Wir sind gerade in der dritten Welle der Autokratisierung. Wir haben das erste Mal seit, ich glaube jeher, mehr Autokratien auf der Welt als Demokratien und es ist eine zentrale Frage, wie wir damit umgehen. Und ein Punkt ist natürlich: Natürlich müssen wir den Binnenmarkt attraktiver machen, aber wir müssen auch unsere Demokratie resilienter machen.
Carsten Roemheld: Genau, und vielleicht Freihandelsabkommen natürlich auch abschließen weiterhin mit Staaten wie Kanada, USA, das sind ja Dinge, die wahrscheinlich im Raum stehen und aus dieser Sicht auch notwendig werden. Wie groß schätzen Sie denn die geostrategische Gestaltungsmacht der EU überhaupt ein? Sollte oder muss Europa autonomer werden? Oder brauchen wir im Gegenteil noch engere Verflechtungen, wie ich ja gerade auch angesprochen habe, mit ausgewählten Partnern, um Macht zu entfalten und Einfluss zu sichern?
Katrin Kamin: Ja, also ich glaube, man muss dann immer einmal hingucken, was ist der Status quo. Und die EU ist nach wie vor ein sehr wichtiger Handelspartner, wir sind immer noch die wichtigste Handelsmacht der Welt. Ich habe es schon gesagt, wenn man alles zusammenzählt, also Güter und Dienstleistungen, dann sind wir für fast 60 % der Länder der wichtigste Exportmarkt. Und ich glaube, das ist was, das ist wichtig, aber das muss man natürlich auch pflegen. Und wir sehen auch in anderen Teilen der Welt Bewegung. Also wir sehen nämlich, wenn man sich dann anguckt, was für Handelsabkommen ist die EU gerade am Schließen oder wo wird gerade verhandelt, dann sehen wir zum Beispiel ein Stocken in den Mercosur-Verhandlungen. Wir sehen ein Stocken auch in den Verhandlungen mit Indien. Wir sehen aber demgegenüber zum Beispiel ein frisch geschlossenes RCEP-Abkommen im asiatischen Raum. Wir müssen Handelsabkommen weiter vorantreiben. Das ist, denke ich, die Kernkompetenz und Kernstärke der EU.
Zu Ihrer Frage, welche geostrategische Gestaltungsmacht die EU hat: Wir sind, glaube ich, noch so ein bisschen in der Zeit der Wiege sozusagen der geostrategischen Gestaltungsmacht, weil wir ja auch gerade erst lernen uns zu emanzipieren von den USA. Also die USA haben sich auch zurückgezogen aus ihrer Rolle als Hegemon, während China aufgestiegen ist. Und das war jetzt oder ist jetzt auch unter Biden dann nicht mehr komplett zurückgedreht worden. Trump hat sehr viele Handelsbeschränkungen erlassen, die unter Biden gar nicht zurückgenommen wurden. Da hatte sich Europa, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft und es ist nicht passiert.
Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, weil wir dann jetzt auch gezwungen waren, mal uns damit ein bisschen mehr zu beschäftigen. Ich denke schon, dass über diesen Handelshebel einiges passieren kann, und ich denke, ein wichtiger Punkt ist die Diversifikation von Lieferländern. Bei bestimmten Ressourcen und bei bestimmten Gütern, da sind wir abhängig und da müssen wir gucken, dass wir mehr Lieferländer bekommen. Wie gehen wir in Zukunft zum Beispiel mit autokratischen Ländern um, wie wollen wir die Handelsbeziehungen hier gestalten.
Carsten Roemheld: Für eine größere Unabhängigkeit der EU gibt es ja auch dieses Gemeinschaftsprojekt IPCEI ‚Important Projects of Common European Interest‘. Da plant man, den europäischen Anteil zum Beispiel an der weltweiten Halbleiterproduktion bis 2030 auf 20 % steigen zu lassen. Ist das zum Beispiel kluge Geopolitik in dem Sinne, wie Sie sie verstehen?
Katrin Kamin: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also gerade die Ökonomen streiten sich dann darüber, wie viel sollte der Staat jetzt mit Subventionen eingreifen an so einer Stelle. Aus der geoökonomischen Perspektive muss ich sagen: Ja, das macht total Sinn, denn wie soll es anders gehen. Also wenn man sich mal anguckt, wo die Halbleiterproduktion konzentriert ist, die wichtige Halbleiterproduktion und ich meine jetzt nicht Halbleiter für Rasenmäher und Rasierapparat oder so, sondern ich meine … Ich weiß gar nicht, ob Rasierapparate überhaupt Halbleiter haben … (lacht)
Carsten Roemheld: Wahrscheinlich. Alles hat heute Halbleiter! (lacht)
Katrin Kamin: … aber Rasenmäher auf jeden Fall! Ich meine wirklich die, die eben wichtig sind, ‚High-Technology Semiconductors‘. Dann also, ja dann muss man natürlich sagen, ist es relevant, die ist in superkritischen Ländern konzentriert momentan. Und mit kritisch meine ich jetzt nicht politisch kritisch, aber wenn wir uns Taiwan angucken und die Frage, ob China da irgendwann mal einmarschiert, dann ja. Also ‚Contested States‘ sozusagen. Von dem Gesichtspunkt aus würde ich sagen: Ja, macht Sinn, aber natürlich muss man immer gucken, wie stark werden Dinge subventioniert. Ist es sinnvoll, dass der Staat da so stark eingreift? Und das werden die nächsten Jahre natürlich auch zeigen. Also die sehr liberalen Hardcore-Ökonomen würden sagen: „Nein, das macht keinen Sinn, das muss alles der freie Markt regeln.“
Aber da, denke ich, ist eben nicht der sicherheitspolitische Concern mit eingepreist und das ist eben was, das jetzt gerade in der Ökonomie dazukommt, nachdem wir jetzt gelernt haben, wir müssen umweltpolitische Bedenken mit einpreisen, jetzt müssen auch noch sicherheitspolitische Bedenken mit eingepreist werden. Das sind alles externe Effekte, die nicht mit eingepreist wurden bisher.
Carsten Roemheld: Der Ruf nach dem starken Staat ist in letzter Zeit öfter mal aufgekommen, insofern gilt es, das sicherlich abzuwägen. Aber Sie empfehlen auch für Deutschland selbst eine geoökonomische Strategie, um den Wohlstand zu erhalten. In dem Gutachten für das Außenministerium empfehlen Sie den Aufbau und Ausbau bilateraler strategischer Partnerschaften unter anderem mit den USA und mit Indien. Warum genau bilateral und nicht mit anderen europäischen Partnern zum Beispiel und warum Indien?
Katrin Kamin: Es ist so ein bisschen zu unterscheiden zwischen dem Gutachten, das wir fürs Außenministerium geschrieben haben, da ging es um den europäischen Blick und der europäische Blick ist ja dann natürlich der: Die EU verhandelt ihren Außenhandel bilateral mit anderen Ländern wie zum Beispiel USA – das transatlantische Abkommen ist ja auch im Gespräch – oder eben auch Indien. Für Deutschland muss man gucken, das hatten wir auch in dem FAZ-Artikel geschrieben, auch da muss die EU sozusagen die Handelsverhandlungen führen, aber nichtsdestotrotz sollte man sozusagen strategische Partnerschaften aufbauen, zum Beispiel im Mittelmeerraum, wie wir schon besprochen hatten.
Ja, warum Indien? Indien ist zum einen wichtiger Partner, wenn es um den regelbasierten Welthandel geht, einfach auch als ein großes Land. Es gibt ja auch schon diverse Partnerschaften zwischen der EU und Indien, zum Beispiel diese Energie- und Klimapartnerschaft, die sehr wichtig ist; gerade auch, wenn man die Industrien in Indien betrachtet. Und der Handel zwischen der EU und Indien war jetzt gar nicht so groß, machte 2020 nur 1,8 % aus, aber der Handel ist sehr stark gestiegen in den letzten 10 Jahren, ich meine: um 72 %. Und deswegen wird Indien sozusagen als ein Markt betrachtet, auf den wir gucken sollten.
Carsten Roemheld: Sehr gut. Vielleicht ein letztes Wort zu Deutschland und der ja sehr auch hierzulande vorherrschenden Rohstoffknappheit. Deutschland denkt ja neu über seine nationalen Energiereserven nach. Ist es sinnvoll, dass man jetzt über Vorratshaltung versucht, hier auch ein bisschen stärker auf Resilienz zu bauen? Ist das aus Ihrer Sicht ein Teil einer Strategie neben vielleicht der Diversifizierung von weiteren Handelspartnern?
Katrin Kamin: Ja, das ist ein Teil, wie Sie sagen, ein Teil der Strategie. Es ist eine Möglichkeit und vor allem in den Bereichen, wo wir sagen, das sind strategische Güter, wo wir Sorge haben, dass es vielleicht irgendwann mal zu einer Knappheit kommt, oder wo absehbar ist, dass es zu einer Knappheit kommt – wobei es dann meistens schon zu spät ist. (lacht) Also in so einem Bereich wäre eine Vorratshaltung eine Möglichkeit.
Eine andere Möglichkeit, Sie haben es gesagt, ist natürlich Diversifizierung von Lieferländern. Aber – wir hatten vorhin auch schon drüber gesprochen – verstärkte Investitionen in manchen Bereichen, gerade was den Bergbausektor angeht, wäre auch eine Möglichkeit.
Carsten Roemheld: Wir haben jetzt viel über Güter als Waffen gesprochen, über geoökonomische Attacken und ihre Abwehr über die neue Rolle Europas. Lassen Sie uns noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Eine der größten Herausforderungen wird es für die EU sein, das Gleichgewicht zu finden zwischen der multilateralen Offenheit einerseits und der ausreichenden Autonomie und Unabhängigkeit andererseits. Sie haben ja immer wieder, auch in den vergangenen Jahren, eine neue Außen- und Handelsstrategie angemahnt, für Deutschland genauso wie für die gesamte EU. Was muss da genau drinstehen?
Katrin Kamin: Das werden wir oft gefragt, (lacht) was da drinstehen soll. Also es geht eben vor allem um die Einbeziehung geopolitischer und sicherheitspolitischer Gesichtspunkte. Und das ist eben was, das wurde bisher zu sehr vernachlässigt. Ich habe es eben schon gesagt, das kann eigentlich aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht betrachtet werden wie ein externer Effekt. Und wir haben jetzt leider live erleben können, was es bedeutet, wenn man sich dann plötzlich umstellen muss. Und sozusagen eine langfristige oder längerfristige Absicherung in bestimmten Bereichen ist, denke ich, sinnvoll.
Was bedeutet das aber? Also es bedeutet, dass wir gerade, wenn wir uns die Handelspolitik angucken, die im Zweifel noch mal mehr überfrachten mit noch einem zusätzlichen Ziel, was erfüllt werden muss durch Handelspolitik und wir haben schon sehr viele Ziele, die durch Handelspolitik erfüllt werden müssen. Also wir bauen da gerade umweltpolitische Ziele ein, wir bauen Sozialstandards ein, denken jetzt an die Lieferkettengesetze und so weiter. Und das ist immer schwierig.
Ich glaube, zum einen – um jetzt mal konkret auf Ihre Frage zu antworten –, zum einen muss in so einer Strategie drin sein: Was sind eigentlich unsere Ziele, was sind unsere strategischen Interessen? Und davon leiten sich dann die Ziele ab. Und dann muss man sich über die Instrumentarien Gedanken machen: Also welche Instrumente können wir nutzen, um diese Ziele zu erreichen?
Und ich denke, ein wichtiger Faktor, der in Deutschland und teilweise auch in der EU bisher noch sehr vernachlässigt wurde, ist einfach auch das Bewusstsein, dass man, wenn man drohen möchte, ich sage nicht, dass es das Mittel der Wahl ist, aber wenn man drohen möchte, dann muss es eine glaubwürdige Drohung sein. Das ist so, egal, ob wir über Sanktionen sprechen oder über irgendwas anderes. Und das ist leider so, wie Abschreckung funktioniert. Und das ist was, das muss, glaube ich, noch stärker zurück ins Bewusstsein in Deutschland, aber auch in der EU.
Carsten Roemheld: Sie haben gerade einen Aspekt angesprochen, den wir bisher erst am Rande erwähnt haben: Nämlich Handelsthemen sind immer stärker auch mit Klima- und Umweltfragen verknüpft. Woher beziehen wir beispielsweise künftig unsere Energie? Was sagen Sie dazu?
Katrin Kamin: Also wir hatten es ja schon einmal kurz angesprochen: Ich denke, ein wichtiger Raum ist der Mittelmeerraum. Da müssen wir aus unterschiedlichen Gründen gucken, aber eben auch aus den Gründen der Energieversorgung. Und gerade, wenn es um Dekarbonisierung geht und um grünen Strom der Solarenergie im Mittelmeerraum, ist das, denke ich, ein Punkt, wo man hingucken könnte.
Aber wir sehen ja jetzt auch gerade in der Krise, dass plötzlich sehr viele neue Quellen aufgetan werden für Energie. Und auch da muss man gucken, ob das langfristige Quellen sind oder ob es da eher um eine kurz- bis mittelfristige Versorgung geht in Zeiten des Krieges. Aber auch hier stellt sich für mich dann immer diese Frage: Vorher waren wir abhängig von einer russischen Autokratie und jetzt gehen wir vielleicht hin zu anderen autokratischen Ländern und auch da, denke ich, ist Vorsicht geboten, dass man sich jetzt nicht woanders abhängig macht von ähnlichen Strukturen.
Carsten Roemheld: Entscheidend dürfte wahrscheinlich eine Diversifikation über möglichst mehrere Lieferanten sein; dass man eben nicht so viel Abhängigkeiten zeigt, wie wir es zum Beispiel von Russland jetzt gemacht haben. Und eine andere Sache, die mit der Resilienz wahrscheinlich auch verknüpft ist: Es wird mit etwas höheren Kosten verbunden sein, diese Resilienz in den entsprechenden Lieferketten einzubauen. Ich glaube, das dürfte auch eine Folge sein, der wir uns nicht entziehen können. Sie haben auch schon angeregt, Deutschland soll an der Gründung eines Klimaklubs mitarbeiten. Was steckt denn genau da dahinter?
Katrin Kamin: Hinter einem Klimaklub steckt eigentlich die Idee, dass es ein Abkommen gibt zwischen mehreren Ländern, preferably natürlich USA, China, Europa, wo man sich verpflichtet, bestimmte inländische Klimamaßnahmen umzusetzen. Und es geht aber auch um koordinierte CO2-Grenzausgleichsmaßnahmen. Das heißt, es geht darum, dass eine Steuer auf Treibhausgase von Importen erhoben wird. Und entscheidend dafür ist, dass sozusagen zwischen den Klubmitgliedern diese Steuer entfällt, aber sie diese Steuer nach außen hin umsetzen und diesen Ausgleichsmechanismus im Handel mit anderen Ländern umsetzen, sodass Anreize geschaffen werden, entweder Mitglied des Klubs zu werden oder eben sozusagen generell den CO2-Ausstoss zu reduzieren. Der Vollständigkeit halber: Das haben gar nicht wir angeregt, sondern das war mein Kollege Guntram Wolff vom Thinktank Bruegel in Brüssel, mit dem wir aber auch die Studie gemacht haben.
Carsten Roemheld: Das klingt ja mal nach einer wirklich guten Initiative. Noch eine letzte Frage vielleicht zum Thema WHO: Welche Rolle spielt denn die WHO, die Welthandelsorganisation? WTO! Entschuldigung noch mal: WTO. Denken Sie, dass wir künftig weiterhin neue Weltstandards für den Handel setzen können?
Katrin Kamin: Ja, das ist eine sehr gute Frage – schwierig zu beantworten. Die WHO … WTO! Entschuldigung, jetzt sage ich es auch schon. (lacht) Die WTO war ja schon seit dem Scheitern von Davos eigentlich in der Krise und wir haben ja nun eine neue Chefin, Ngozi Okonjo-Iweala. Ich denke, die bringt sehr viel Power mit und versucht, sehr viel umzusetzen. Wir sehen gerade Veränderungen und Initiativen im Bereich des Dienstleistungshandels und auch im Bereich der Fischerei, die beide sehr wichtig sind.
Aber wie viel Biss sozusagen die WTO haben wird, ist eine gute Frage. Wir haben immer noch eine Blockade seitens der USA und ich denke, was ein relativ wichtiges Signal war oder was ich als wichtiges Signal wahrgenommen habe, ist, dass zumindest China auch sich beteiligt hat mit anderen Ländern, um, wie sagt man, Verhandlungswege zu finden innerhalb der WTO; ohne sozusagen über den ‚Appellate Body‘, der ja gerade blockiert ist, zu gehen. Das fand ich ein Signal, dass auch für China die WTO eine Rolle spielt und alles Weitere ist ein bisschen Zukunftsmusik. Wir müssen abwarten, würde ich sagen.
Carsten Roemheld: Das wäre jedenfalls eine schöne Nachricht, wenn wir das insgesamt als Basis nutzen könnten für gemeinsame Gespräche und für die neue Weltordnung sozusagen. Sehr schön, Frau Kamin, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Wir kommen zum Ende unseres Podcasts, die Zeit ist leider abgelaufen. Aber ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses sehr spannende Gespräch und würde mich freuen, wenn wir uns in Zukunft noch mal unterhalten könnten über die verschiedenen Stati, die wir dann erreichen werden.
Vielen Dank, Frau Dr. Kamin.
Katrin Kamin: Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank!

Katrin Kamin
Katrin Kamin ist PostDoc und stellvertretende Leiterin des Forschungszentrums Trade Policy am Kiel Institut für Weltwirtschaft. Sie studierte Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien mit Schwerpunkt Politikwissenschaft in Passau. Anschließend promovierte sie bei Holger Görg zum Thema „International Trade and Conflict: Determinants, Impact, Endogeneity and Data“ an der Universität Kiel.
Sie forscht zu Internationalem Handel und Internationaler Politischer Ökonomie mit besonderem Schwerpunkt auf Geoökonomie. Insbesondere arbeitet sie zu den Wechselwirkungen zwischen ökonomischen und politischen Variablen, wie z.B. Demokratisierung und Konflikten mit Handel. Aktuell beschäftigt sich Katrin Kamin insbesondere mit der Geoökonomisierung der europäischen und deutschen Außenhandelspolitik, den Folgen von Sanktionen und dem Einfluss von (geopolitischen) Konflikten auf Investments.
Abonnieren Sie unsere Podcasts
Das könnte Sie auch interessieren
Kapitalmarkt-Blog mit Carsten Roemheld
Meinungsstark, auf den Punkt und immer am Puls der Zeit. Einschätzungen und Hintergründe zu allem, was die Kapitalmärkte bewegt.
Mehr erfahren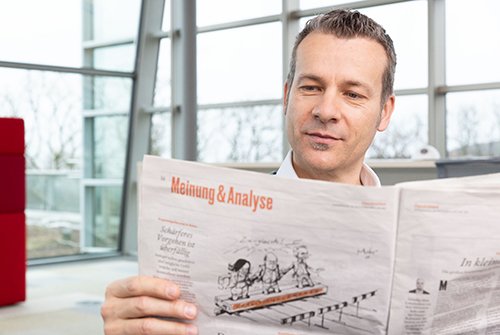

Bleiben Sie informiert
Mit unseren kostenlosen Newslettern bleiben Sie immer am Ball. Erfahren Sie aktuell, was die Märkte und Anleger bewegt.
Bitte wählen Sie:

Sprechen Sie uns an
Sie möchten mehr über unsere Fonds und Anlagelösungen erfahren oder haben Fragen zu Ihrer Geldanlage? Unser Team unterstützt Sie jederzeit gerne.
Ansprechpartner finden
Produkte & Services
Sind Sie auf der Suche nach Fondsinformationen oder der geeigneten Anlageform für Ihr Portfolio? Hier finden Sie die richtige Anlagelösung für jede Lebenssituation.
Jetzt entdeckenWichtige Informationen
Diese Aufzeichnung darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch verbreitet werden. Für die in der vorliegenden Aufzeichnung gemachten Aussagen ist der jeweils benannte Gesprächspartner verantwortlich. Der Inhalt spiegelt nicht zwangsläufig die Meinung von Fidelity International wider. Alle hier bereitgestellten Informationen dienen lediglich Informationszwecken sowie dem Zweck der Meinungsbildung. Eine Rechtsberatung findet nicht statt. Fidelity International übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Sichtweisen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Fidelity International übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung dieser Informationen herrühren. Diese Aufzeichnung stellt keine Handlungsgrundlage oder Anlageberatung dar. Die FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen, erteilt keine Anlageempfehlung / Anlageberatung und nimmt keine Kundenklassifizierung vor. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Kundeninformationsdokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“ und des veröffentlichten Verkaufsprospekts, des letzten Geschäftsberichts und — sofern nachfolgend veröffentlicht — des jüngsten Halbjahresberichts getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufs. Anleger in Deutschland können diese Unterlagen kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main, oder über https://www.fidelity.de anfordern. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Sollten in der Aufzeichnung Unternehmen genannt werden, dienen diese nur der Illustration und sind nicht als Kaufs- oder Verkaufsempfehlung zu verstehen. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das „F-Symbol“ sind Markenzeichen von FIL Limited. FIL steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften.
Herausgeber für professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; Herausgeber für institutionelle Anleger: FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Zweigniederlassung Deutschland: FIL (Luxembourg) S.A. — Germany Branch, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; für den Bereich Betriebliche Vorsorge: FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; für Privatkunden: FIL Fondsbank GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.
Stand: Juni 2022
MK14174
Rechtliche Hinweise
- Impressum
- Rechtliche Hinweise
- Datenschutzhinweise
- Cookie-Richtlinien
- Bericht über die Ausführungsqualität der FIL Fondsbank GmbH
- Abstimmungsverhalten der FIL Fondsbank GmbH
- Informationen zur Nachhaltigkeit der FIL Fondsbank GmbH
- Risikohinweise
- Anlegerinformationen und Fondspreise mit Ertrags- und Steuerdaten

