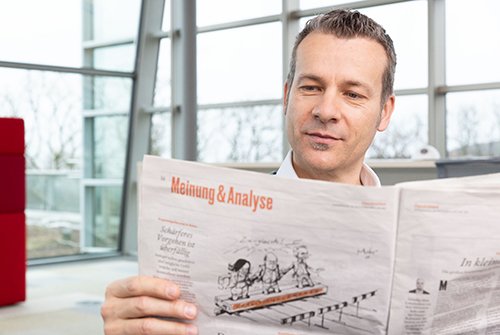Carsten Roemheld: Wir alle nutzen sie täglich und ein Leben ohne sie kann man sich kaum noch vorstellen. Ich spreche von digitalen Plattformen, auf denen wir uns ständig aufhalten. Sie verbinden uns mit unseren Freunden, Kollegen und mit dem Rest der Welt. Sie beantworten unsere Fragen, sie informieren und sie unterhalten uns auf Knopfdruck. Und tagtäglich füttern wir Instagram, Facebook, Google, Teams und ChatGPT mit unseren Informationen.
Das alles ist nicht unproblematisch, denn je mehr wir von uns preisgeben und je mehr wir die Plattformen nutzen, umso stärker werden wir abhängig von einer Handvoll meist US-amerikanischer oder chinesischer Unternehmen. Mit unseren Daten geben wir den Tech-Konzernen eine Menge Macht. Mit dem Ergebnis, dass diese Unternehmen es längst geschafft haben, Regulierungen zu umgehen und sich kaum mehr für Themen wie Jugendschutz, Menschenwürde oder Wahrhaftigkeit interessieren. Big Tech hat damit das Potenzial, unsere Demokratie zu zerstören, sagen Kritiker.
Und einen dieser Kritiker habe ich heute zu Gast in meinem Podcast. Martin Andree lehrt Medienwissenschaft an der Universität zu Köln und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Dominanz der Digitalkonzerne und deren Auswirkungen. Er hat zu dem Thema mehrere Bücher geschrieben. Erst kürzlich ist sein Buch „Krieg der Medien" erschienen. Im Jahr 2024 hat er für seinen Bestseller „Big Tech muss weg" den Günter-Wallraff-Sonderpreis für Pressefreiheit und Menschenrechte erhalten.
Wir sprechen heute darüber, wie gefährdet wir in Europa und in Deutschland sind. Was er damit meint, wenn er sagt „Wir befinden uns in einem Krieg der Medien". Und was wir tun können, um da herauszukommen. Heute ist der 2. September 2025. Mein Name ist Carsten Roemheld. Ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity. Und Sie hören den Fidelity Kapitalmarkt Podcast.
Ich freue mich sehr auf Antworten auf diese Fragen und weitere spannende Eindrücke in den kommenden 45 Minuten mit Martin Andree. Herzlich willkommen zu unserem Podcast!
Martin Andree: Schönen guten Tag, Herr Roemheld.
Carsten Roemheld: Kommen wir gleich einmal auf die Big-Tech-Konzerne und den Einfluss in Europa zu sprechen. Sie sprechen in Ihrem Buch „Krieg der Medien" immer wieder von den sogenannten "Dark Tech"-Konzernen. Vielleicht können Sie uns mal kurz erklären: Wer zählt alles zu diesen Unternehmen und warum stehen sie auf der dunklen Seite?
Martin Andree: Diese ganze Geschichte habe ich tatsächlich auch in meinem letzten Buch beschrieben. Das sind die Tech-Konzerne, die wir alle kennen, die sich ja auch super inszeniert haben in der Vergangenheit, dass sie eine bessere Welt schaffen wollen, für „Freedom of speech", und wollen Interaktion und Partizipation und „Be part of our community".
Wir erinnern uns an diesen ganzen Nebelkerzen-Talk aus den Nuller- und Zehnerjahren. Die haben uns da ein bisschen eingelullt, und vielleicht waren die auch vor 20, 30 Jahren in ihren Garagen mal gut. Aber dass die auf der dunklen Seite der Macht sind, das hat mittlerweile glaube ich, jeder kapiert. Die Frage ist eher, ab wann wir es eigentlich hätten verstehen müssen.
Eigentlich müsste man ja sagen: spätestens bei der Prism-Affäre 2013, als bekannt wurde, dass die Tech-Konzerne ihre Nutzer nicht nur hinter ihrem Rücken ausgespäht haben, sondern diese Daten auch an die Geheimdienste der US-Regierung weitergegeben haben. Spätestens 2013 hätten wir verstehen müssen, dass sie auf der dunklen Seite der Macht agieren.
Und was im letzten Jahr passiert ist: Sie sind im Prinzip Teil von Team Trump geworden. Diese Koalition aus der Trump-Regierung und den Tech-Konzernen will gerade die europäische Digitalregulierung abschaffen, sie verbünden sich sogar mit rechtsradikalen Parteien. Das hat ja wirklich jetzt jeder verstanden.
Carsten Roemheld: Und wie gefährlich sind diese Konzerne jetzt? Wie genau gefährden sie den öffentlichen Diskurs, zum Beispiel in Europa?
Martin Andree: Das ist eine gute Frage, und ich weiß, dass das natürlich hier ein Podcast mit einem wirtschaftsaffinen Publikum ist. Deswegen würde ich das erst mal gerne über einen Umweg beschreiben, denn ich komme ja tatsächlich auch aus einer sehr starken Free-Market und wirtschaftsliberalen Perspektive.
Erstmal ist klar, dass diese Tech-Konzerne Monopole aufbauen, und zweitens ist auch klar, dass sie das absichtlich tun. Übrigens, wenn man in 100 Jahren auf diese Zeit zurückblickt, kann niemand denen vorwerfen, dass sie das im Geheimen geplant haben. Wir kennen das von Peter Thiel: „Competition is for losers". Dass die absichtliche Konstruktion von Monopolen und die Abschaffung von freien Märkten, offenem Wettbewerb und Chancengleichheit zum Programm dieser Tech-Konzerne gehört, das ist eh klar.
Jetzt wird es aber ganz interessant. Jetzt könnte man vielleicht sagen, wenn man extrem naiv ist: „Ist halt egal bei der Wirtschaft, dann haben wir halt keine freien Märkte, keinen offenen Zugang, keinen Wettbewerb mehr. Dann müssen Verbraucher zum Beispiel typischerweise unter Monopolbedingungen mehr zahlen. Aber wo ist da die große Bedrohung?“
Und da wird es dann ganz interessant. Dann kommt sozusagen mein Fach ins Spiel. Ich bin Medienwissenschaftler. Und das ist eben insofern interessant, dass Medienmonopole eigentlich verfassungswidrig sind. Die darf man auf keinen Fall akzeptieren, weil bei Medienmonopolen geht es immer um das Thema Meinungsmacht. Wer einmal eine demokratierelevante Mediengattung monopolisiert, der kontrolliert damit so viel Meinungsmacht, dass man das in Demokratien niemals akzeptieren darf.
Nur einmal als Beispiel: Es wäre auch in Deutschland gar nicht möglich, dass zum Beispiel RTL 90 Prozent des Fernsehens kontrolliert. Genau diese Situation haben wir jetzt mit diesen digitalen Medienmonopolen.
Carsten Roemheld: Und wie üben diese Unternehmen die Macht genau aus? Welchen Einfluss haben die Unternehmen genau auf die europäische Öffentlichkeit? Sie sprechen ja immer auch von einem Krieg. Vielleicht kann man das noch mal in den Zusammenhang bringen.
Martin Andree: Ich schreibe ja auch in der Einleitung: Diese Begrifflichkeit des Krieges kommt gar nicht von mir, sondern diese Begrifflichkeit des Krieges kommt von diesen antidemokratischen Warlords selbst. Das fängt schon an in den 90er-Jahren. Schauen wir uns mal eine programmatische Schrift des Vordenkers dieser Bewegung an. Das ist „The Sovereign Individual" von Davidson und Rees-Mogg. Da ist im Prinzip eine Art Anleitung niedergelegt.
Übrigens ganz interessant hier in so einem kapitalmarktaffinen Umfeld, die sagen nämlich den Anlegern: „Hey, guck mal, das ist doch total cool, diese digitale Transformation. Der demokratische Staat wird sowieso untergehen. Und das ist eine riesengroße Gelegenheit, diese digitale Transformation für uns Investoren, denn wir können uns an dem Untergang dieses demokratischen Staates noch bereichern." Und wie machen wir das? Indem wir Unternehmensstrukturen bauen, die sich eigentlich über den demokratischen Staat setzen. Deswegen sind es auch diese souveränen Individuen. Das sind typischerweise geniale, weiße Unternehmergenies, die dann sozusagen ihre eigenen Mikrostaaten bauen und damit eigentlich den demokratischen Staat unter sich lassen und in Anarchie und Chaos hinterlassen. Und das nennen die schon damals 1997 „Information War".
Da merken Sie daran, dass das nicht irgendwie von mir erfunden ist. Und nur um das auch noch zu ergänzen: Das ist eines der Lieblingsbücher von Peter Thiel. Das heißt, die meisten Sachen, die Sie von Peter Thiel lesen, sind eigentlich inspiriert aus diesem Buch. Und ich erinnere vielleicht noch einmal kurz daran: Letztes Jahr schrieb Elon Musk auf seiner Plattform „Civil war is inevitable". Also wir haben diese Kriegsmetaphorik überall, und auch da teilen uns diese Tech-Libertären ganz offen mit, was sie vorhaben. Die halten nicht damit hinterm Berg.
Carsten Roemheld: Jetzt klingt es ja einerseits sehr dystopisch, andererseits klingt es so, wie Sie es beschreiben, dass das Ganze sozusagen von langer Hand geplant wurde. Ist das so, dass diese Art der Unternehmensbildung und der Ausbau dieser Systeme von langer Hand geplant war? Oder ist das im Laufe der Zeit entstanden, weil man dann gemerkt hat, wie viel Macht man überhaupt mit diesen Unternehmen ausüben kann? Wie kann man das vielleicht von der Evolutionsgeschichte her verstehen?
Martin Andree: Also ich würde zwei Worte aufgreifen: dystopisch und geplant. Das „dystopisch" würde ich zurückweisen. Ich höre das übrigens auch manchmal in meinen Talks – „Das ist aber total dystopisch" – und ich sage den Leuten auch immer: Dieses Ausmaß der Monopolbildung, was ich zeige und auch wissenschaftlich dokumentiere, ist empirisch geprüft. Das ist auch nichts, was in 30 Jahren ist. Das ist der Status quo. Daran ist nichts dystopisch, das ist die Jetztzeit. Das ist nicht irgendwie eine Extrapolation in die Zukunft.
Und ich glaube auch, das, was wir gerade in den USA sehen und das, was die Tech-Konzerne ja auch tun – denn sie hätten ja übrigens dieses Bündnis mit der Trump-Regierung auch zurückweisen können. Sie hätten ja auch sagen können: „Also mit Autokraten gehen wir nicht ins Bett." Sie hätten auch der US-Regierung drohen können, dass sie ihre Headquarter ins freie Europa zum Beispiel verlegen könnten, wenn die Trump-Regierung die Sphäre der Demokratie verlässt. Das haben sie nicht getan. Also das, was ich beschreibe, ist einfach Status quo und es sehen ja auch die Leute da draußen, was passiert.
Das zweite Wort, was Sie gesagt haben – „geplant" – würde suggerieren, dass es irgendwo sozusagen so eine Art Mastermind gibt. Das würde ich tatsächlich zurückweisen. Natürlich gibt es das nicht. Es ist ja auch sogar so, dass die Tech-Konzerne untereinander in einer Art Wettbewerb stehen. Denn sie haben zwar Monopole auf einzelnen Feldern, aber es sind ja immerhin noch mehrere.
Diese unterschiedlichen Felder, die sich da zusammengetan haben, die haben auch sicherlich in Details unterschiedliche Interessen. Das heißt, die Trump-Regierung hat eine eigene Agenda, die Tech-Konzerne haben eine Agenda, und die AfD und die anderen rechtspopulistischen Verbündeten haben eine eigene Agenda. Und auch übrigens Putin, der ja hier auch lustig mitmischt, hat eine eigene Agenda.
Von daher ist es eine locker verbundene Interessensgemeinschaft. Aber in einem Punkt sind sie sich einig: Sie hassen den demokratischen Staat. Sie wollen die Souveränität des demokratischen Staates abbauen, und sie mögen die angebliche Regulierung nicht. Da können wir später darauf zurückkommen, weil ich das auch zurückweisen würde. Also ich würde eher sagen, dass die Tech-Konzerne uns regulieren, aber das können wir später diskutieren.
Sie wollen eigentlich die EU schwächen, die Demokratie schwächen und mögliche Digitalregulierung abschaffen. Das ist quasi der innerste Kern der Interessen. Und auf diesem Feld haben sie sich eben zusammengefunden. Was aber eben schrecklich ist, ist, dass das eben eine sehr, sehr starke, geballte Macht ist, die uns da bedroht.
Carsten Roemheld: Wie kommt es eigentlich gerade in den USA, dass sich die Meinung dann doch sehr gedreht hat? Ich erinnere mich daran, dass eigentlich in einem früheren Stadium Trump und die Tech-Konzerne eher querlagen und dass die großen CEOs nicht unbedingt Donald Trump unterstützt haben. Aber das hat sich jetzt irgendwie doch stärker geändert. Ist das eigentlich eine opportunistische Art und Weise, sozusagen den jeweils Stärkeren mit ins Boot zu nehmen und damit eine noch stärkere Gemeinschaft zu gründen? Oder wie ist dieser Wechsel in der Meinung gekommen?
Martin Andree: Das ist super, dass Sie das ansprechen, und ich glaube, es ist einer der größten Irrtümer in der Betrachtung dieser ganzen Angelegenheit. Denn es gibt so eine Art Märchen, dass die Tech-Konzerne früher links oder sowas gewesen wären und dass sie dann quasi ihre Meinung geändert haben. In meinen Augen oder auch nach meiner Forschung ist das Unsinn.
Die Tech-Konzerne haben immer ein politisches Programm des Libertarismus vertreten, und zwar haben sie das auch in unterschiedlichen Facettierungen ausgedrückt. Und es ist übrigens auch ganz interessant, dass einige das radikaler formuliert haben. Auch einige Vordenker aus dieser Bewegung, die gesagt haben wie Peter Thiel: „Democracy and Freedom are incompatible", also Demokratie und Freiheit vertragen sich nicht. Dass man eigentlich die Demokratie abschaffen müsste und durch eine Art CEO-König ersetzen müsste, wie zum Beispiel auch Curtis Yarvin, einer der Vordenker dieser Bewegung.
Und jetzt könnte man natürlich einwenden, dass es Konzerne gibt, die diese radikalen, antidemokratischen bis faschistoiden Ideen nicht explizit so ausgedrückt haben. Aber wenn Sie sich mal zum Beispiel „The Digital Age" anschauen von Eric Schmidt, damals CEO von Google, und wenn Sie genau zwischen den Zeilen lesen, dann werden Sie auch darin ein Programm finden, wonach im Prinzip die Tech-Konzerne auch schon damals - das war also in den Zehnerjahren - gesagt haben: „Es bricht eine neue Ära an. In dieser neuen Ära müssen die demokratischen Staaten Souveränität abgeben."
Und sie haben sich damals aufgespielt als Befreier. Aber wir merken ja sofort, wenn wir darüber nachdenken, dass auch das eine Art Irrtum ist. Denn die demokratischen Staaten waren immer schon von den Menschen geprägt. Demokratie besteht darin, dass wir diesen Staat selbst gestalten. Und wenn dort behauptet wird, wir müssen diese demokratische Souveränität im Prinzip abbauen, dann ist natürlich die Frage: Wo geht diese Souveränität, wo geht diese Macht hin? Und sie geht natürlich in die Konzerne, die sich eigentlich als eine Art antistaatliche Macht aufbauen.
Und das entspricht natürlich auch genau dem, was sie getan haben. Denn sie haben sich natürlich auch in ihren lobbyistischen Bemühungen und in ihren regulatorischen Bemühungen massiv darum bemüht, genau diese Souveränität des demokratischen Staates abzubauen. Und das kann man gar nicht dramatisch genug einschätzen, weil es da eigentlich um uns als Gemeinschaft geht, als demokratische Gemeinschaft. Dürfen wir in unseren Ländern denn eigentlich noch selbst bestimmen, was passiert? Und jetzt merken wir gerade, was passiert: Nämlich die EU kann schon gar nichts mehr durchsetzen, und die Tech-Konzerne und die Trump-Regierung herrschen hier schon mit. Und das ist genau das, was sie in solchen Büchern in den Zehnerjahren auch schon mitlesen können, wenn sie genau lesen. Und wir müssen uns eher an die eigene Nase packen, warum wir so dumm waren, und auf diese Nebelkerzen reingefallen sind, dass diese Konzerne sich als Weltverbesserer aufgespielt haben. Und vielleicht nur, um das noch zu ergänzen: Auch dieses Element des Abschieds aus dem demokratischen Staat durch den Aufbau von globalen extraterritorialen Unternehmensstrukturen, die zum Beispiel keine Steuern mehr zahlen, auch das ist ja alles nach dem Playbook der Libertären. Also man kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass wir da viel spekulieren müssen, um diese Agenda herauszufinden, die die haben.
Carsten Roemheld: Sie hatten vorhin auch schon mal Bezug genommen auf Wahlkampf, Demokratie, Einflussnahme von Seiten der USA. Gerade die Plattform X von Elon Musk hat sich jetzt in den Wahlkampf doch relativ deutlich eingemischt, eine klare Parteinahme auch für die AfD demonstriert, hat mit Alice Weidel ein langes Gespräch veröffentlicht. Ist das ein Punkt, der bald zur Tagesordnung gehört, dass sozusagen diese großen sozialen Medien hier Plattformen bieten für bestimmte Parteien? Und anders gesagt, auch in den USA stelle ich ja fest: Auch der Presseraum des Weißen Hauses sieht inzwischen völlig anders aus als vorher, wo etablierte Medien eigentlich mehr und mehr entfernt werden und zunehmend eben neue Medien, auch Influencer – wie auch immer man die Personen nennen mag – die sozusagen die Regierungspartei unterstützen, sitzen. Also auch eine wirklich bewusst andere Zusammensetzung. Wird das in Zukunft auch ein größeres Thema werden?
Martin Andree: Ich würde sagen, dass es noch viel schlimmer ist als das, weil natürlich ist es am offensichtlichsten, wenn Elon Musk seine Plattform und die Meinungsmacht dieser Plattform offen instrumentalisiert, um hier schon Wahlkampf für seine trumpistischen Buddies zu machen. Wo wir ja schon eigentlich merken müssten, was hier passiert. Vor allem, wenn wir uns vor Augen halten, dass es auch Verlautbarungen gibt aus dem US-Außenministerium, wonach jetzt die USA „Civilizational Allies" aufbauen müssen in Europa – zivilisatorische Verbündete – womit sie explizit solche Parteien wie die AfD meinen. Damit werden rechtsradikale Parteien wie die AfD quasi zu den offiziellen Verbündeten der Trump-Regierung.
Es ist aber noch viel schlimmer als das, weil medienwissenschaftliche Studien eben auch zeigen können, dass rechtsradikale Positionen auf diesen Plattformen viel stärker ausgespielt werden als andere. Und das ist übrigens für uns immer in der Kausalität sehr schwer zu beschreiben, weil wir natürlich keinen Zugang in diese Plattformen hinein haben. Die lassen uns da nicht reinschauen. Aber auch da ist eigentlich die Perspektive meines Fachs eine ganz interessante, denn ich predige das ja übrigens schon seit 10, 15 Jahren: Es ist eigentlich egal, ob die Monopolisten gut oder böse sind. Monopolisten sind im Feld der Medien tabu.
Ich illustriere es noch mal mit einem Vergleich: Stellen Sie sich jetzt vor, wir hätten diese antimonopolistischen Regelungen nicht gehabt in der Vergangenheit, und stellen wir uns jetzt vor, dass ähnlich wie Google die Suchmaschinen kontrolliert oder Meta zum Beispiel Social Media, dass RTL in Deutschland 90 Prozent des Fernsehens kontrollieren würde. Wenn wir dann das Management ansprechen würden, dann würden die uns auch sagen: „Aber wieso? Was habt ihr denn da für ein Problem damit? Wir haben hier total neutrale Redaktionen, und wir halten uns da total raus. Wir sagen doch auch nicht den Journalistinnen und Journalisten, was die schreiben sollen. Also braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen zu machen."
Und wir merken ja sofort, wie unglaublich naiv das wäre und weswegen es diese Regelung gibt, die zum Beispiel fürs Fernsehen sagen: Egal, was sie uns erzählen - 30 Prozent Maximum. Wir brauchen Anbietervielfalt. Wir brauchen Pluralismus. Wir dürfen das niemals haben.
Und jeder da draußen weiß ja, dass die Tech-Konzerne sowieso mit der Traffic-Manipulation ihr Geld verdienen, häufig natürlich oder hauptsächlich zu ökonomischen Zwecken. Das merkt ja jeder, der im Kontext zum Beispiel von bestimmten Inhalten auf bestimmte Werbung verwiesen wird. Diese Tech-Konzerne haben aber eben auch eine politische Agenda, eine libertäre Agenda. Und deswegen ist es auch nicht überraschend, dass solche Inhalte auf den Plattformen bevorzugt ausgespielt werden. Und deswegen nochmal: Es ist egal, ob die gut oder böse sind. Es ist egal, ob Trump Präsident ist oder ob Kamala Harris Präsidentin wäre. Medienmonopole sind inakzeptabel, sind tabu. Die darf man niemals haben, und die gehören abgeschafft.
Carsten Roemheld: Eine Frage zu der Aussicht auf das politische Parteienspektrum hier in Europa: Was glauben Sie, wie sich diese Machtmonopole und diese Tech-Unternehmen, die hier Einfluss nehmen, auf den Erfolg von politischen Parteien hier in Europa auswirken werden? Müssen die Parteien in irgendeiner Art und Weise auch mehr digitale Medien nutzen? Müssen sie mehr versuchen, dort auch Fuß zu fassen? Oder wird das politische Spektrum sich komplett verändern in der Form, dass die etablierten Parteien, die es früher mal gab, irgendwie in Zukunft keine größere Rolle mehr spielen? Die Linken haben beispielsweise einen großen Erfolg gehabt durch eine Social-Media-Kampagne, die jetzt relativ stark davon profitiert haben. Die Frage ist: Kann man sagen, welche Parteien und welche Enden davon profitieren werden? Oder ist das bisher nicht möglich?
Martin Andree: Natürlich, Sie haben völlig recht. Interessant ist aber natürlich, dass auch auf der linken Seite eher radikale Positionen gefördert werden. Das entspricht genau dem, was wir auch in der Plattformwirklichkeit sehen, dass eben Polarisierung und Radikalisierung gefördert wird. Und jetzt gibt es natürlich ein Problem, weil moderate Parteien mit moderaten Positionen jetzt in einem Dilemma sind – und ich nenne das in dem Buch ja auch immer wieder ein Lose-Lose-Dilemma. Was übrigens ganz ähnlich auch für journalistische Anbieter gilt: Wenn Sie moderate Positionen und balancierte Positionen vertreten, dann gehen sie quasi in dieser digitalen Plattformwirklichkeit unter. Und was machen die Politiker? Die rennen jetzt in Social-Media-Coachings. Und dann lernen sie, wie man das irgendwie cool auf TikTok macht. Und wir sehen es ja, im Buch beschreibe ich das ja auch an Söder sehr schön: Man wird dann Food-Influencer. Und wenn wir jetzt darüber lachen, muss uns ja das Lachen im Hals stecken bleiben, weil die Politiker eigentlich dann zu Marionetten werden, die nach Tech-Algorithmen tanzen. Sie sind ja eigentlich gar nicht mehr frei. Das Gleiche gilt übrigens auch für journalistische Inhalte.
Und jetzt wird es eigentlich ganz interessant, auch mit Ihrem Zuhörerkreis. Denn gerade konservative oder wirtschaftsliberale Parteien stehen hier vor einem riesengroßen Problem. Und übrigens adressiere ich das auch seit vielen Jahren: Eigentlich ist es ja so, dass jeder Mensch, der wirtschaftsliberal oder unternehmerisch denkt, Monopole auch sofort ablehnen müsste. Allerdings ist meine Erfahrung, dass das innerhalb wirtschaftsliberaler Kreise ein ganz schwieriges Thema ist. Und das hat einen ganz einfachen Hintergrund: In der Vergangenheit, schauen wir uns mal die letzten 50, 60 Jahre der Bundesrepublik an, war es so, dass die wirtschaftsliberalen Parteien und ihre Anhänger – also ich sage mal CDU oder FDP – die waren typischerweise eher ein bisschen näher an der Macht. Sie hatten eine höhere Affinität zur Wirtschaftsmacht und auch zur politischen Macht. Und die Kritik an der Macht, die kam dann tendenziell eher von linken Parteien.
Und jetzt haben wir eine ganz neue Situation, weil ja eigentlich jeder, der wirtschaftsliberal denkt, sofort merken müsste: „Die Monopolisten, es geht ja gar nicht. Das geht gegen alle meine Prinzipien, gegen alle meine Werte, offene Märkte, gleicher Zugang und so weiter und so fort.“ Das heißt, rein rational betrachtet müssten wir eine riesengroße Revolution sehen bei Leuten, die typischerweise CDU oder FDP wählen, weil die sagen: „Also diese Monopole müssen wir abschaffen."
Das Problem ist nur, dass wir diese Revolution oder diesen Aufstand nicht sehen. Und warum ist das so? Weil natürlich Herrschaftskritik nicht zum typischen Arsenal dieser Parteien gehört. Und deswegen tut man sich schwer damit. Also Leute, die solche Parteien wählen, die sind gerne auf der Seite des Erfolgs. Die wollen tolle Autos fahren, die wollen gerne Geld verdienen, die wollen Umsatzwachstum machen und so weiter und so fort. Und deswegen merken wir gerade, dass diese Parteien eigentlich so ein bisschen gespalten werden. Ich spreche da übrigens auch mit allen Parteien, und es ist super interessant, dass wir in diesen Parteien dann eigentlich mittlerweile zwei Lager haben, wenn man mit denen spricht. Das eine Lager, das sind, würde ich sagen, die anständigen Wirtschaftsliberalen, die das auch wirklich schlimm finden. Die sagen: „Da müssen wir was tun, das müssen wir ändern" und so weiter und so fort.
Und dann haben wir aber ein anderes Lager, wo man das Gefühl hat, da fühlen die sich nicht so wohl mit. Und die fangen an, sich mit dieser Situation zu arrangieren. Und dann flackert das Ganze dann ganz schnell Richtung AfD. Und weil einem nichts Besseres einfällt, dann bashen wir noch ein bisschen die Grünen. Und ich hoffe nur, dass wirtschaftsliberale Kreise in Deutschland verstehen, was hier auf dem Spiel steht. Denn die digitalen Märkte sind ja die Zukunftsmärkte. Und deswegen muss ja jedem klar sein: Natürlich können wir jetzt irgendwie versuchen, kurzfristig hier noch ein paar Chancen rauszuholen, indem wir mit diesen antidemokratischen Tech-Konzernen zusammenarbeiten. Aber eigentlich müsste auch jeder, der wirtschaftsliberal denkt, verstehen, dass hier eigentlich auch die Zukunft unserer Wirtschaft auf dem Spiel steht. Und deswegen hoffe ich ganz stark, dass da einige Menschen noch ein Einsehen haben.
Carsten Roemheld: Lassen Sie uns noch einmal über die Gefahren sprechen, die entstehen, wenn wir uns in Europa von Big-Tech-Konzernen abhängig machen. Die russischen Desinformationskampagnen bezeichnete die Bundesregierung zuletzt als hybride Bedrohung, als quasi als kriegerischen Akt. Müssen wir durch die Big-Tech-Konzerne ähnlich gravierende Probleme fürchten?
Martin Andree: Natürlich. Sie müssen sich auch vor Augen halten, dass zum Beispiel diese ganzen Fälle, die ja detailliert dokumentiert sind, wo zigtausende Fake-Accounts genutzt wurden, um russische Propaganda in Deutschland zu verbreiten, um die Menschen in Deutschland auch zu verunsichern und in Angst und Schrecken zu versetzen - dass die Plattformen mit diesen ganzen Inhalten Geld verdienen. Und sie verdienen auch mit anderen strafbaren Inhalten Geld. Es ist total egal, ob es hier um Verleumdung geht, um Aufforderungen zu Straftaten, um Diskriminierung, Rassismus, um Holocaustleugnung und so weiter und so fort. Und da fangen wir auch schon an, wieder in Themen reinzukommen, um die es auch in meinem neuen Buch geht. Das sind alles Regulierungen, die uns die Tech-Konzerne ja aufgezwungen haben. Es gibt ein Meme, das ganz gerne mal auf LinkedIn geteilt wird: „America innovates, China replicates, EU regulates."
Und wenn wir jetzt ein bisschen schlauer wären und genauer hinschauen würden, dann würden wir merken, dass ja das Gegenteil der Fall ist. Das heißt, die Tech-Konzerne haben es geschafft, dass sie ein ganzes Arsenal von Rechtsprivilegien haben. Und das, was ich gerade genannt habe, ist eins davon - das sind sogar mehrere. Das ist erstmal ein sogenanntes Intermediärsprivileg, dass sie nicht als Medien zählen. Das ist zweitens ein Haftungsprivileg, dass sie nicht haften müssen. Und es ist drittens ein Straftatenprivileg, dass sie mit Straftaten Geld verdienen dürfen.
Und jeder da draußen, der sich das hier anhört, der mag mal in die Reflexion gehen und darf sich gerne mal überlegen: In welchem Feld erlauben wir es denn in Deutschland, Wirtschaftsakteuren – übrigens sehr, sehr starken Wirtschaftsakteuren – mit strafbaren Inhalten Geld zu verdienen? Stellen Sie sich jetzt mal vor, der Rewe um die Ecke, der würde den Leuten Crack verkaufen. Und wenn Sie zu Rewe sagen würden: „Das finde ich aber nicht so cool, dass ihr da mit diesem ganzen Crack Geld verdient", und der Rewe würde sagen: „Ja, aber wieso? Da habe ich doch nichts mit zu tun. Ich habe dieses Crack doch nicht selber gemacht. Ich bin nur Intermediär." Und da merken wir schon, was das für ein Wahnsinn ist und dass es hier eine neue Betrachtung erfordert. Denn wir waren tatsächlich auch noch so doof, dass wir den Tech-Konzernen diese Rechtsprivilegien eingeräumt haben. Und wir sind tatsächlich obendrein noch so doof, dass wir tatsächlich dann solche Memes auf Social Media posten: „America innovates and EU regulates", obwohl wir ja eigentlich in Wirklichkeit von den Tech-Konzernen und ihren Rechtsprivilegien reguliert werden.
Carsten Roemheld: Sie haben ein sehr gutes Beispiel gerade genannt, finde ich. Das war sehr, sehr einprägsam, noch mal das Ganze klarzumachen, wie die Plattformen zu sehen sind. Ich habe mal eine Frage, die mir gerade eingefallen ist: Es gibt ja immer wieder die Auseinandersetzung auch zwischen den großen Medienkonzernen und Staaten, sozusagen die Plattform zu öffnen, wenn es um kriminelle Handlungen geht und ähnliche Dinge, eine Backdoor einzurichten, um Namen herauszufinden und so weiter. Was halten Sie davon? Die Konzerne scheinen ja im Moment irgendwie die größere Macht auf ihrer Seite zu haben und teilweise den Staaten nur unter größten Kraftanstrengungen oder gar nicht zu ermöglichen, überhaupt dahinter zu blicken. Aber wie sehen Sie denn diese Möglichkeit der Staaten, sozusagen bei Tech-Konzernen eine Tür zu haben, um eben bei kriminellen Handlungen dort einschreiten zu können?
Martin Andree: Es ist so, dass ich natürlich dieses Feld seit 15 Jahren bearbeite, und deswegen haben wir ein ganz ausgearbeitetes Set an Lösungsvorschlägen entwickelt, von der Universität Köln, auch mit sehr, sehr viel juristischer Kompetenz. Und wenn Sie mir diese Frage stellen, kann ich auf ein Prinzip verweisen, was sich in diesen Ausarbeitungen verbirgt. Und zwar ist das ein ganz einfaches Prinzip: Wer monetarisiert, muss haften.
Es ist total logisch, und ich kann das noch mal an einem Beispiel zeigen: Die Tech-Konzerne haben damals, als diese Debatte aufkam in den 90er Jahren, gesagt: „Schaut mal, vergleichen wir das mal mit so einem Telefonnetzwerk. Und stellen wir uns vor, Terroristen, die telefonieren über ein Telefonnetzwerk der Telekom. Da können wir ja auch nicht die Telekom dafür verantwortlich machen, dass Terroristen darüber telefonieren." Und da würde ich sagen: „Hey Leute, total, habt ihr gut verstanden, ich folge diesem Punkt." Dann haben sie gesagt: „Okay, also möchten wir auch wie Telefonnetzwerke reguliert werden." Und da würde ich sagen: „Das ist auch total okay. Werdet als Telefon oder so ähnlich wie Netzwerke reguliert." Aber - und jetzt kommt der entscheidende Fehler: Ein Netzwerk kann niemals mit konkreten Inhalten Geld verdienen. Also wieder am Beispiel der Telekom: Die Telekom verdient nicht über konkrete Inhalte Geld. Die Plattformen aber schon. Die verdienen genauso wie jeder journalistische Inhalteanbieter mit konkreten Inhalten Geld.
Also, um es jetzt wieder auf Ihre Frage zurückzuführen: Es ist ja ganz einfach. Wir können denen sagen: „Hey, ihr wollt wie Netzwerke reguliert werden, das ist ja euer Vorschlag. Super! Seid ihr Netzwerke? Könnt ihr halt nur leider niemals Inhalte monetarisieren. It's not our problem, it's your problem". Und wenn ihr sagt: „Okay, das finden wir aber doof, weil wir würden ja gerne weiter Geld verdienen mit den Inhalten", dann würden wir sagen: „Okay, alles klar, wenn ihr Inhalte monetarisieren wollt, ist auch okay für uns. Aber dann seid ihr voll in der Haftung." Und da merkt man sofort: Mit einem Fingerschnippen hat man das komplette Problem gelöst. Dasselbe Prinzip „Haftung bei Monetarisierung", das gilt ja in der gesamten Wirtschaft.
Also stellen Sie sich das doch mal bitte vor: Der Supermarkt würde sagen: „Ich habe damit nichts zu tun." Aber er verkauft das Crack doch. Da kann ja keiner sagen: „Also ich kann damit Geld verdienen und übernehme keine Haftung." Und da merken Sie erneut: Es ist ein Irrtum, wenn Leute sagen, die langweiligen Regulierer sollen jetzt mal hier nicht die Märkte abwürgen, diese Ideologien, die wirklich Quatsch sind. Wir haben rechtliche Vorzugsbehandlung und Rechtsprivilegien für diese Tech-Konzerne geschaffen, ohne die sie überhaupt nicht existieren könnten und ohne die ihre Monopole sofort zu Staub zerfallen würden. Das heißt, es liegt auch an uns. Wir können das gestalten. Und wie gesagt, wenn wir denen sagen: „Hey, wollt ihr jetzt wirklich Netzwerkbetreiber sein oder wollt ihr Inhalteanbieter sein?", dann haben wir schnell Klarheit. Aber wir haben leider nicht den Mut, hier klare Verhältnisse zu schaffen.
Carsten Roemheld: Und das ist genau die Frage: Wie kommen wir jetzt hier weiter? Die EU hat ja ihren Digital Markets Act und hat auch schon einige Strafen ausgesprochen - 700 Millionen Euro zum Beispiel. Einige sagen, das ist sehr moderat das Ganze und Verfahren verzögern sich. J.D. Vance, der US-Vizepräsident, hat schon gesagt, dass man auch über die NATO nachdenken muss, wenn diese Regulierung entsprechend verschärft wird. Also wir lassen uns schon politisch in gewisser Weise erpressen, und deswegen kommt diese Regulierung gegenüber diesen großen Konzernen nicht zum Zuge. Ist das die richtige Einschätzung?
Martin Andree: Das ist die richtige Einschätzung, und ich würde jetzt tatsächlich auch die Gelegenheit nutzen, hier die extreme Bedeutung der Wirtschaft noch mal zu äußern. Denn wir haben eine Regierung Merz, die sehr, sehr stark auch natürlich - weil die CDU ist eine sehr wirtschaftsaffine Partei - die tatsächlich auch auf die Wirtschaft hört. Und jetzt gibt es wieder zwei Möglichkeiten, wie sich die Wirtschaft verhält. Die eine Möglichkeit ist - und ich kann das ja verstehen, wenn ich jetzt CEO eines DAX-Konzerns bin, dann denke ich auch nur an die nächsten Quartale und ich denke vielleicht kurzfristig und ich denke: "Oh Gott, diese Zölle."
Aber wenn man ein bisschen schlauer ist und über das nächste Quartal hinweg denkt, dann müssten wir doch völlig klar auch in der Wirtschaft sehen, dass wir diesen Kampf nicht gewinnen können. Ich möchte mal ein Beispiel nennen: Es gibt eine Studie der Amazon-freundlichen Beratung Oliver Wyman – das sind also keine Marxisten – und die haben in ihrer Studie gezeigt, dass schon jetzt 30 Prozent aller Hersteller auf Amazon kein Geld mehr verdienen. Warum verdienen sie kein Geld? Weil es genauso ist wie in allen monopolistischen Situationen. Amazon kann sozusagen immer mehr Geld, immer mehr Gebühren und unterschiedliche Wertschöpfungsanteile von den Herstellern abziehen. Und irgendwann stehen sie blank da.
Und wenn sie dann kein Geld mehr auf Amazon verdienen, dann wird Amazon ihnen übrigens sagen: „Hey, du willst nicht mehr auf Amazon unterwegs sein. Das ist kein Problem. Hau ab! Es geht doch." Sie haben unter Umständen 10, 15 Jahre das Geschäft aufgebaut. Amazon hat sie seit 10 oder 15 Jahren komplett ausgehorcht. Amazon weiß mehr als sie selbst über ihre eigenen Produkte, weil es die ganzen Daten einkassiert hat zu ihren Transaktionen. Amazon kann mit Lohnherstellern draußen ihre Produkte nachbauen. Amazon hat schon 140 Eigenmarken.
Jeder in der Wirtschaft, der denkt, dass wir mittelfristig hier mit einem blauen Auge davonkommen, der ist auf dem Holzweg. Wir haben gerade zum Beispiel auch gesehen beim kooperativen Verhältnis der Werbeindustrie mit den Tech-Konzernen auf Online Marketing Rockstars. Da gehen wir hin und finden das alle total cool. Zuckerberg hat jetzt gerade gesagt, er holt sich in Zukunft das komplette Agenturgeschäft, weil es in Zukunft keine Agentur mehr braucht. Das heißt, wir kooperieren da noch ein paar Jahre und dann machen die uns weg.
Und tatsächlich ist das die große Chance. Denn wenn wir in wirtschaftsaffinen Kreisen in Deutschland ein Umdenken hätten, wenn wir merken würden, dass wir auf Grundlage unserer wirtschaftsliberalen Free-Market-Philosophie Monopole nicht zulassen können. Dass es dieselben Mechanismen sind, die unsere Wirtschaft zerstören und Wertschöpfung aus unserer Wirtschaft rausziehen, die eben auch unsere Demokratie zerstören, dann wäre es ganz einfach. Aber solange wir uns jetzt nur kurzfristig ins Hemd machen aufgrund der Zölle und nicht den mittelfristigen Zeitrahmen beachten, dann wird es hier ein Problem geben.
Carsten Roemheld: Es läuft immer wieder auf das Gleiche hinaus. Europa muss irgendwie zur eigenen Stärke finden und muss auch mal den Mut haben, irgendwo entgegenzutreten. Denn in allen Punkten kuschen wir ein bisschen zurück, haben Angst vor der großen Macht der USA oder anderen Nationen und machen uns wahrscheinlich viel kleiner als wir sind. Wahrscheinlich könnte die EU durch ihre Wirtschaftsmacht sehr viel stärker auftreten, aber irgendwie scheint es nicht in unseren Genen zu sein. Sie haben auch mal gesagt: „In Europa kriegen wir bald amerikanische Verhältnisse." Können Sie das noch mal vielleicht ein bisschen näher beschreiben, was das bedeutet?
Martin Andree: Ja, wir erleben es ja, dass es immer weiter kippt. Interessant ist: Ich habe das Exposé zu meinem Buch letztes Jahr im Sommer abgegeben mit diesem schrecklichen Untertitel „Dark Tech und Populisten übernehmen die Macht". Das war im Juli letzten Jahres. Das Manuskript wurde abgegeben im April. Jetzt hat mittlerweile schon die AfD hat nach der letzten Forsa-Umfrage die CDU überholt. Wir haben gerade zum Beispiel die Debatte gesehen um die neue Verfassungsrichterin Brosius-Gersdorf, die getragen wurde von Desinformation, Fake News, Falschinformationen, Hass und Hetze über die Plattformen. Und wo ja ganz schrecklich ist, dass sich die Lügner sozusagen durchgesetzt haben am Ende. Das heißt, da sehen wir das ja schon.
Wir sehen immer mehr ein Flirten von Politikern mit populistischen Positionen, die wir eher aus trumpistischen Kreisen oder der AfD kennen. Und das ist auch nachvollziehbar aus meiner wissenschaftlichen Perspektive. Denn wer die Medien kontrolliert, der kontrolliert die Öffentlichkeit. Und wer die Öffentlichkeit kontrolliert, der kontrolliert auch unsere Demokratie. Wir haben den gestaltenden Zugriff auf unsere Medienöffentlichkeit verloren. Diese digitale Öffentlichkeit wird festgelegt von Algorithmen und Nutzungsbedingungen, die die Tech-Konzerne uns aufzwingen. Wir haben kein Mitspracherecht mehr. Und erneut würde ich sagen: Tech reguliert uns doch längst. Denn innerhalb der Plattform dürfen die Tech-Konzerne ihre Nutzungsbedingungen und Algorithmen frei festlegen.
Und wenn wir das nicht merken, dass eigentlich uns die Grundlage unserer Demokratie abhandenkommt und wir es nicht mehr selbst gestalten können, dann könnten wir es eigentlich auch ändern. Und das erfordert aber, dass wir wirklich verstehen, was passiert, und dass wir dabei auch auf der Ebene der Wirtschaft keine Perspektiven haben. Und stellen Sie sich nur vor, wenn die gesamte Wirtschaft bei Friedrich Merz an die Tür bollern würde und sagen würde: „Hey, das geht auf keinen Fall. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das stoppen. Und wir sind auch bereit, da kurzfristig bestimmte Rückschläge hinzunehmen. Aber es ist sowohl für unsere Demokratie als auch für unsere Wirtschaft tödlich, wenn wir Deals mit diesen monopolistischen Tech-Konzernen oder mit den Autokraten auf der anderen Seite des Atlantiks machen."
Carsten Roemheld: Auf den Punkt möchte ich jetzt am Schluss noch mal gerne zu sprechen kommen, weil ich möchte dem Ganzen doch noch, wenn es irgendwie geht, einen kleinen positiven Dreh am Schluss verpassen. Sie haben jetzt gesagt: Alternativen, die wir hier in Europa vielleicht aufbauen könnten. Ich meine, die großen Monopole haben inzwischen eine riesige Marktmacht erreicht. Gibt es aus Ihrer Sicht Chancen, in verschiedenen Bereichen Alternativen aufzubauen? Netzwerke, Cloud-Anbieter, Software? Palantir ist ja ein Beispiel, was bei uns jetzt schon wirklich tief in den Systemen verankert ist. Gibt es eine Chance, dass man vielleicht den Weg doch noch stoppen kann? Die Kontrolle irgendwie wieder zurückbekommen kann, dass sich bestimmte Alternativen hier entwickeln lassen, wenn wir jetzt sagen würden: "Ab sofort ist Schluss und wir versuchen mehr auf eigenen Beinen zu stehen"? Halten Sie es für realistisch, und wie wäre es möglich?
Martin Andree: Ja, und ich will da auch noch mal so ein Narrativ umdrehen. Sie kennen diese Erzählung von der „German Angst“ und „wir sind immer so innovationsscheu" und „wir wollen das Neue nicht" und so weiter und so fort. Und ich würde das einfach mal auf den Kopf stellen und sagen: Es ist vielleicht eher „German Angst“ in Bezug auf digitale Souveränität. Vielleicht ist es auch eher deutsches Untertanendenken. Und wenn wir diese „German Angst“ in diesem Feld überwinden würden, würde ich sagen, ist das ein bisschen wie der Vogel, der jetzt im Käfig sitzt, obwohl die Tür ja eigentlich auf ist. Und der sich gar nicht mehr traut, diesen Käfig zu verlassen. Wenn er den Käfig verlassen würde, vielleicht würde die Welt schon ganz anders aussehen.
Denn in dem Augenblick, wo wir diese Privilegien und Vorzugsbehandlung der Tech-Konzerne sofort abschaffen, in dem Augenblick hat die deutsche Digitalwirtschaft auch eine ganz andere Chance. Interessant ist, dass ich zum Beispiel schon mal bei einer Tech-Investorenkonferenz war, und die haben mir gesagt: „Schön, dass Sie diese Monopole mal wissenschaftlich vermessen haben. Das wissen wir ja alle. Wir würden niemals Alternativen mit Kapital ausstatten, weil wir wissen, dass die unter monopolistischen Bedingungen keine Chance haben."
Und jetzt stellen Sie sich vor, wir würden den Vogel aus dem Käfig mal rauslassen und wir würden den Amerikanern sagen: „Wir haben hier freie Märkte. Monopole gibt es hier nicht." Dann hätten Sie sofort auch eine völlig andere Kapitalausstattung der Alternativen. Das heißt, die Alternativen könnten viel schneller aufholen. Wir haben super starke Leute hier in Europa, innovative Leute, und dann hätten die Alternativen auch eine Möglichkeit zu florieren. Und dasselbe gilt ja übrigens auch für digitale Geschäftsmodelle innerhalb unserer Wirtschaft, innerhalb der existierenden Konzerne.
Das heißt , German Angst heißt hier in erster Linie: Wir denken, dass wir nur in diesem Käfig der digitalen Abhängigkeit leben können. Wer sagt denn, dass das so ist? Wenn wir den Käfig verlassen, dann können wir hier unser eigenes Ding machen und vielleicht haben wir dann wieder fünf Prozent Wirtschaftswachstum jedes Jahr nach zwei, drei Jahren. Weil wir nämlich auch in den digitalen Zukunftsmärkten die Rolle einnehmen können, die uns eigentlich zusteht.
Carsten Roemheld: Also Sie sagen, wir haben hier die innovativen Kräfte, wir haben hier das Kapital, wir haben hier die Grundbausteine eigentlich schon parat, um die Dinge in die Hand nehmen zu können. Wir müssen nur den ersten Schritt tun und die Macht begrenzen, die Monopolstrukturen zerschlagen, um das dann ausnutzen zu können. Aber Sie sagen, die Voraussetzungen sind da, wenn ich Sie richtig verstehe.
Martin Andree: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, das ist das Schöne am offenen Markt, am freien Wettbewerb. Die Investoren sind ja egoistisch. Das heißt, wenn die Investoren sehen: „Hier ist ein riesengroßer Markt, nämlich die EU, die machen Ernst mit offenen Märkten in der digitalen Sphäre. Das ist jetzt kein Witz". Und wir wissen doch, was die Tech-Konzerne an Umsätzen und an Profiten erwirtschaften. Das können wir ja einfach nur extrapolieren, was da an Potenzial ist.
Und ich würde sogar denken, das wäre tatsächlich sogar das Beste für die Tech-Konzerne. Denn die Tech-Konzerne verbringen wahrscheinlich 80 oder 90 Prozent ihrer geistigen Energie damit, ihre Monopole abzusichern, anstatt Innovationen nach vorne zu treiben. Und ich glaube tatsächlich, das würde für die Tech-Konzerne super sein, wenn ein Unternehmen wie Apple nicht mehr ein Unternehmen, sondern 20 wären. Dann hätte das wahrscheinlich eine höhere Bewertung an den Börsen und es wäre auch viel besser für diese einzelnen Unternehmen, denn die würden viel mehr im Wettbewerb stehen und da ginge es dann nicht mehr nur darum, die eigene monopolistische Herrschaft abzusichern.
Carsten Roemheld: Also sozusagen eine Win-Win-Situation. Dann wollen wir dafür sorgen, dass dieser Podcast viral geht, dass Ideen aus dem Podcast sehr breit aufgegriffen werden. Vielen, vielen Dank, Herr Andre. Ich habe Ihre Zeit schon deutlich überbeansprucht. Ich danke Ihnen vielmals für dieses sehr, sehr spannende Gespräche und hoffe, dass die Zuhörer hier einiges mitnehmen konnten.
Martin Andree: Ich danke Ihnen.
Carsten Roemheld: Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, es war genauso spannend für Sie wie für mich. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bei einem der nächsten Formate oder der nächsten Ausgabe dieses Podcasts wiedersehen. Vielen Dank! Herzliche Grüße, Ihr Carsten Roemheld.