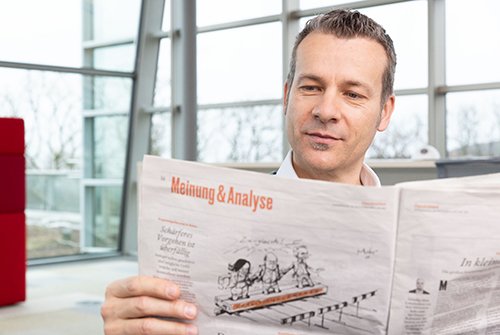Carsten Roemheld: Finanztransaktionen, Lieferketten, Ernteprognosen und Wettervorhersagen – all das funktioniert nicht ohne Ortungssysteme wie GPS und Erdbeobachtungen aus dem Weltall. Unsere Wirtschaft und unser Alltag sind heute eng mit Raumfahrttechnologien verknüpft – so eng, dass wir uns das moderne Leben ohne sie kaum mehr vorstellen können. Doch mit diesen technologischen Vorteilen entstehen auch Abhängigkeiten, etwa vom Satelliteninternet Starlink des Tech-Milliardärs Elon Musk. Wie geht man mit solchen Herausforderungen um? Welche Rolle könnten deutsche und europäische Unternehmen dabei spielen? Und wer reguliert eigentlich, was über unseren Köpfen im Weltall passiert?
Über diese Fragen spreche ich heute mit Matthias Wachter, Abteilungsleiter für Internationale Zusammenarbeit, Sicherheit, Rohstoffe und Raumfahrt beim Bundesverband der Deutschen Industrie. Er ist außerdem Geschäftsführer der German New Space Initiative und ein prominenter Fürsprecher für Innovation und privatwirtschaftliches Engagement im deutschen und europäischen Raumfahrtsektor. Mit ihm diskutiere ich, wie abhängig wir wirklich sind von Technik aus dem All und Anbietern wie Starlink, welche Chancen die neue Ära der Raumfahrt – der sogenannte New Space – bietet und wie wir das Problem des Weltraumschrotts lösen können. Heute ist der 22. Oktober 2025. Mein Name ist Carsten Roemheld, ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity, und Sie hören den Fidelity Kapitalmarktpodcast. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Matthias Wachter. Herzlich willkommen!
Matthias Wachter: Herzlichen Dank für die Einladung.
Carsten Roemheld: Die meisten Menschen denken beim Thema Raumfahrt zuerst an bemannte Missionen wie etwa die Mondlandung oder die Raumstation ISS. Aber tatsächlich steckt viel mehr dahinter, als man gemeinhin annimmt. Können Sie zu Beginn erklären, wie wir sowohl im Alltag als auch wirtschaftlich von Satellitentechnologien und Daten aus dem All abhängig sind?
Matthias Wachter: Sehr gern. Wir sind heute stark davon abhängig. Vielen Menschen ist das gar nicht vollständig bewusst. Raumfahrt wird häufig mit der Kolonialisierung des Mars oder Milliardären mit verrückten Plänen verbunden. Das ist die eine Seite. Die andere, viel bedeutendere Seite ist jedoch die wirtschaftliche und alltägliche Bedeutung. Die globale Space Economy hat derzeit ein Umsatzvolumen von etwa 500 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen rund 150 Milliarden auf Hardware – also Satelliten, Raketen und Bodensegmente. Mit 350 Milliarden entfällt der Großteil aber bereits auf datengetriebene Anwendungen. Raumfahrt ist also schon heute ein Datenbusiness. Die von Satelliten erzeugten und übertragenen Daten werden für nahezu alle Lebensbereiche wichtiger, zum Beispiel für die deutsche Industrie. Das autonome und vernetzte Fahren braucht Daten aus dem All – Positionsdaten, Vernetzung, Kommunikation. Wenn wir über Zukunftstechnologien wie Industrie 4.0 reden – IoT – und die Vernetzung von Produktionsprozessen, dann werden diese Daten auch über Satelliten transportiert. Auch die globalen Finanzmärkte benötigen präzise Zeitstempel, um global Transaktionen tätigen zu können. Und auch die werden durch Satelliten zur Verfügung gestellt. Weil Systeme wie GPS oder Galileo nicht nur Positionsdaten, sondern auch global einheitliche Zeitdaten liefern. Und das ist mindestens genauso wichtig. Also kurz gesagt: Unser Leben und unser Alltag sind heute viel stärker Im Hintergrund von Satellitentechnologien und Weltraumdaten abhängig, als den meisten bewusst ist.
Carsten Roemheld: Aber nicht nur Privatpersonen und Unternehmen sind von Weltraumtechnologien abhängig, sondern auch Staaten. Welche Rolle spielen diese Anwendungen auf staatlicher Ebene?
Matthias Wachter: Raumfahrt ist immer Dual Use. Das heißt, Weltraumtechnologien können theoretisch auch militärisch genutzt werden. Das ist für Staaten und ihre hoheitlichen Aufgaben extrem wichtig. Im Krieg Russlands gegen die Ukraine sehen wir, dass Weltraumanwendungen und Daten aus dem All eine entscheidende Rolle für die ukrainische Verteidigung spielen. Der Informationsvorsprung durch westliche Weltraumsysteme verschafft der Ukraine einen militärischen Vorteil auf dem Schlachtfeld. Deshalb sind Weltraumtechnologien auf staatlicher Ebene so wichtig.
Carsten Roemheld: Gibt es denn – etwas naiv gefragt – eine klare Trennung zwischen staatlicher und privater Nutzung? Oder basieren beide Bereiche, und damit auch kritische und militärisch relevante Infrastruktur, auf denselben Satellitentechnologien?
Matthias Wachter: Ja und nein. Es gibt eine zunehmende Kommerzialisierung des Alls. Es wird als Markt und als Chancenraum immer wichtiger. Deshalb investieren viele private Unternehmen, bauen eigene Fähigkeiten für kommerzielle Dienste auf. Gleichzeitig steigen die staatlichen Ausgaben für militärische Fähigkeiten. Auf den ersten Blick könnte man sagen, das geschieht getrennt voneinander. Aber in der Ukraine sehen wir am Beispiel Starlink deutlich: Ein eigentlich rein kommerzielles Projekt von SpaceX stellt der Ukraine heute kriegsentscheidende Fähigkeiten zur Verfügung. Damit verschwimmen die Grenzen zwischen privater und militärischer Nutzung zunehmend. Im Ernstfall – etwa im Krieg – greifen Staaten also auch auf private und kommerzielle Plattformen zu, wenn sie militärisch relevant sind. Wir sehen also eine enge Verzahnung beider Bereiche, auch wenn sie auf den ersten Blick getrennt erscheinen.
Carsten Roemheld: Sie haben es gerade beschrieben: Auch das Beispiel mit Starlink und der Ukraine ist ja sehr relevant gewesen. Elon Musk hat Starlink anfangs großzügig zur Verfügung gestellt, später aber teilweise auch als Druckmittel genutzt. Dadurch entstehen gewisse Risiken, wenn kritische Infrastrukturen in der Hand privater Anbieter liegen. Auch die amerikanische Raumfahrt hat sich teilweise zurückgezogen und Raketen- sowie Satellitentechnologien zunehmend in private Hände gelegt. Sind damit nicht erhebliche Risiken verbunden?
Matthias Wachter: Was wir in den USA sehen, ist eine Entwicklung, die Ende der 1990er-Jahre begann. Die amerikanische Regierung beschloss damals, sich künftig auf bestimmte Forschungs- und Deep-Space-Explorationsprojekte zu konzentrieren, die weiterhin von der NASA realisiert werden sollten. Alles andere – etwa Versorgungsflüge zur Internationalen Raumstation ISS – sollte nicht mehr von der NASA selbst, sondern von kommerziellen Unternehmen übernommen werden. Der Gedanke dahinter war, dass private Unternehmen, die zudem im Wettbewerb zueinander stehen, Projekte effizienter, innovativer und kostengünstiger realisieren können. Dieser Ansatz hat sich bewährt: Raumfahrt ist insgesamt günstiger geworden, die Startkosten sind gesunken, und der Wettbewerb hat technologische Innovationen hervorgebracht – etwa wiederverwendbare Raketen wie bei SpaceX mit der Falcon und der Falcon Heavy. Ohne diesen Systemwechsel hin zu privaten Anbietern hätte es solche Entwicklungen vermutlich nicht gegeben.
Gleichzeitig hat diese Öffnung dazu geführt, dass immer mehr Dinge im All möglich werden, weil die Transportkosten – nach wie vor der größte Kostenblock – gesunken sind. Der Zugang zum All ist also deutlich erschwinglicher und breiter geworden. Dadurch sind Infrastrukturen und Satellitenkonstellationen kommerziell entstanden, die es vor ein paar Jahren in dieser Form noch nicht gab. Das führt wiederum dazu – Stichwort Ukraine –, dass diese Systeme auch anders genutzt werden können und dadurch Abhängigkeiten entstehen. Wichtig ist, nicht das eine gegen das andere auszuspielen: Für staatliche, hoheitliche Bedarfe braucht es eigene Fähigkeiten und Infrastrukturen. Gleichzeitig gilt es, die Innovationskraft privater Unternehmen, die viele dieser Fortschritte überhaupt erst ermöglichen, weiterhin zu nutzen.
Carsten Roemheld: Jetzt haben wir viel über die USA gesprochen, die in diesem Bereich führend sind. Aber auch die Bundesregierung will in den kommenden Jahren erheblich in Infrastruktur und Verteidigung investieren. Meine Frage: Sind dabei Satelliten und Weltraumsicherheit ein Thema? Sind das Posten in diesem Budget?
Matthias Wachter: Die Antwort ist: Ja. Verteidigungsminister Pistorius hat bei unserem BDI-Weltraumkongress im Herbst diesen Jahres angekündigt, dass die Bundeswehr in den nächsten fünf Jahren insgesamt 35 Milliarden Euro in militärische Weltraumfähigkeiten investieren will. Das ist ein absoluter Gamechanger. Zum Vergleich: Die europäische Raumfahrtagentur ESA hat ein Jahresbudget für Europa von rund sieben Milliarden Euro. Das bedeutet: Deutschland, beziehungsweise die Bundeswehr allein, wird in den kommenden fünf Jahren jährlich so viel für Weltraumfähigkeiten ausgeben wie die gesamte ESA für Europa. Bemerkenswert ist auch, wie dieses Geld ausgegeben werden soll. Der Minister hat angekündigt, in das gesamte Fähigkeitsspektrum zu investieren: Man will eine eigene Launch-Fähigkeit haben, um Satelliten kurzfristig ins All zu transportieren. Man will eine eigene Satellitenkonstellation für sichere militärische Kommunikation haben – eine Art militärisches Starlink. Man will auch die Aufklärungsfähigkeiten im All ausbauen und erweitern. Man will die physische Infrastruktur auf der Erde härten, damit sie vor möglichen Cyberangriffen besser geschützt ist. Man will die dadurch generierten Daten viel besser auswerten können. Außerdem geht es um die Entwicklung eines deutschen Raumflugzeugs, das die Bundeswehr unterstützen wird. Das sind sehr ambitionierte Pläne, die der Minister hier hat. Wenn diese Mittel effizient und klug eingesetzt werden, können sie nicht nur die Sicherheit stärken, sondern auch Innovation und neue Technologien fördern. Das ist eine große Chance für das deutsche New-Space-Ökosystem mit seinen vielen jungen Unternehmen.
Carsten Roemheld: Das klingt im ersten Moment sehr gut – und so, als hätten wir Defizite erkannt, die wir in Zukunft ausgleichen wollen. Sie haben das Budget mit dem der ESA verglichen: 35 Milliarden Euro in fünf Jahren sind eine große Summe. Aber Raumfahrt ist eine kapitalintensive Branche, und wir starten von einer vergleichsweise niedrigen Basis. Reicht dieses Budget Ihrer Meinung nach aus oder müsste man sogar noch mehr Geld ausgeben, um effizient in den Wettbewerb zu gehen?
Matthias Wachter: Die entscheidende Frage ist: Wo will man hin – und mit welchem Anspruch? 35 Milliarden Euro sind eine signifikante Größe. Die Idee des Verteidigungsministers ist, dieses Geld als Katalysator zu nutzen, dem dann weitere private Investitionen und Co-Finanzierungen folgen. Dadurch steigt als positiver Nebeneffekt auch die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Das sehen wir auch in Ländern wie den USA oder Israel: Dort sind hohe Verteidigungsausgaben nicht nur eine Belastung, sondern zugleich ein Treiber für Innovation und Technologien. So werden private Unternehmen und Investitionen befördert, die es in der Form vorher nicht gegeben hätte. Ab einem gewissen Punkt trägt sich das System dann selbst. Das ist keine unrealistische Erwartung. Entscheidend wird sein, dass die 35 Milliarden Euro klug ausgegeben werden – also, dass man Wettbewerb ermöglicht und dass man auch neuen Akteuren eine Chance gibt. Ein Beispiel: Als SpaceX seinen ersten NASA-Auftrag in den USA erhielt, hatte das Unternehmen zuvor drei Fehlstarts hinter sich. Erst beim vierten Versuch hat es geklappt. Ohne diesen NASA-Auftrag wäre SpaceX damals bankrott gewesen. Das weiß man heute nicht mehr, aber das war damals „Spitz auf Knopf“. Die spätere Entwicklung zeigt, wie wichtig solche Chancen sind. Ich bin überzeugt, dass wir in Deutschland technologisch und personell mit unseren Ingenieuren und Unternehmen über das Potenzial verfügen, eine ähnliche Entwicklung zu schaffen. Dabei können verstärkte Investitionen der Bundeswehr einen maßgeblichen Beitrag leisten.
Carsten Roemheld: Sie haben Recht, in diesem Punkt muss man Elon Musk den Hut ziehen. Nachdem er drei gescheiterte Raketenstarts hinter sich hatte und eigentlich alle gesagt haben, das Projekt sei gescheitert, hat er dennoch den Mut aufgebracht, einen vierten und schließlich erfolgreichen Start zu wagen. Diese Art von Optimismus und Mut ist sicherlich wenigen vergönnt. Kommen wir zum Thema Starlink: Die EU plant mit dem Projekt Iris², ein Pendant zu Starlink zu schaffen. Bis 2030 sollen 290 Satelliten im All für eine sichere Kommunikation zwischen Staaten sorgen. Auch Unternehmen sollen das System nutzen können. Halten Sie dafür den Zeitrahmen für realistisch oder ist das ein wenig optimistisch?
Matthias Wachter: Zunächst einmal ist es sehr positiv, dass sich Europa überhaupt auf den Weg macht. Ich erinnere mich an Diskussionen vor einigen Jahren, in denen viele – insbesondere hierzulande – Elon Musk und SpaceX für die Starlink-Pläne belächelt haben. Die Vorstellung, hunderte oder gar tausende Satelliten in den Orbit zu bringen, um schnelles Internet aus dem All zu liefern, hat man nicht wirklich ernst genommen. Diese Sichtweise hat sich erfreulicherweise geändert. Ich glaube, alle haben verstanden, wie wichtig solche Fähigkeiten sind – wirtschaftlich, kommerziell, aber auch strategisch. Letzteres zeigt der Einsatz von Starlink in der Ukraine. Insofern ist es sehr gut, dass Europa mit Iris² eine eigene Lösung aufbauen möchte. Allerdings kommt das Projekt spät. Umso ambitionierter ist der Zeitplan. Schon jetzt gibt es erste Verzögerungen – was bei Raumfahrtprojekten zwar nicht ungewöhnlich ist, da sie sich immer an der Grenze des technologisch Machbaren bewegen. Trotzdem hoffen wir, dass Iris² möglichst zeitnah und mit den vorgesehenen Fähigkeiten realisiert wird.
Allerdings glaube ich auch, dass man bei dem Projekt ein paar Fehler der Vergangenheit wiederholt hat: Es gab kaum Wettbewerb, keine neuen oder jungen Akteure sind beteiligt. Das Projekt wird stark staatlich von der europäischen Kommission gelenkt. Die Vorstellung, dass ein weitgehend staatlich finanziertes und reguliertes Projekt wirklich mit einem kommerziellen System wie Starlink konkurrieren kann, ist mutig. Dennoch ist es wichtig, dass Europa eigene Fähigkeiten aufbaut, und deshalb unterstützen wir das Vorhaben ausdrücklich. Wir hoffen, dass das Projekt erfolgreich realisiert wird.
Carsten Roemheld: Lieber Herr Wachter, in der ersten Podcast-Folge haben wir viel über staatliche Aktivitäten im Weltraum gesprochen. Mittlerweile gibt es aber auch immer mehr private Akteure, die Weltraumtechnologien entwickeln – besonders prominent sicher Elon Musk mit SpaceX. Die Entwicklung nennt sich auch New Space. Wie schlagen sich eigentlich deutsche New-Space-Unternehmen im weltweiten Vergleich? Und wie schätzen Sie deren Erfolgschancen ein?
Matthias Wachter: Ich halte die Erfolgschancen und die Qualität deutscher New-Space-Unternehmen für sehr hoch. Es gibt kein Naturgesetz, das festschreibt, dass nur US-amerikanische Anbieter innovativ und wettbewerbsfähig sein können. Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. In Deutschland ist in den vergangenen Jahren ein dynamisches Ökosystem entstanden, in das viel privates Kapital investiert wurde. Das stimmt mich sehr zuversichtlich. Wir haben alles, was es braucht. Wir haben großartige Gründerinnen und Gründer, Ingenieurinnen und Ingenieure, tolle Start-ups und etablierte Unternehmen mit viel Erfahrung auch in der industriellen Skalierung. Außerdem haben wir tolle Hochschulen mit vielen Ausgründungen. Das ist ein tolles Ökosystem. Da ist eine Aufbruchstimmung da und wir haben alles, was es dazu braucht. Aber - wir brauchen auch die richtigen Rahmenbedingungen. Dazu gehört, dass Staaten und Regierungen nach wie vor eine wichtige Rolle spielen. Einerseits als Kunde, weil sie für hoheitliche Bedarfe Fähigkeiten benötigt. Gleichzeitig sind Regierungen Regelsetzer, die die Rahmenbedingungen bestimmen – etwa bei Exportchancen oder Marktgrößen solcher Unternehmen. Hier gibt es sehr viele Auflagen und Einschränkungen. Wir werden zum Beispiel nicht sehen, dass deutsche oder europäische Unternehmen Satellitenkonstellationen für China aufbauen. Wir werden auch nicht sehen, dass chinesische Satellitenbauer ihre Satelliten mit deutschen oder europäischen Trägerraketen starten. Und auch die amerikanische Regierung fährt den klaren Ansatz, dass alles, was sie haben und was sie ins All bringen, immer mit amerikanischen Unternehmen transportiert und realisiert werden muss.
Wir haben keinen wirklichen globalen Markt im Bereich der Raumfahrt, weil es sehr stark um strategische, hoheitliche Fähigkeiten geht. Deshalb ist das eingegrenzt. Umso wichtiger ist es, dass Europa und Deutschland in ihre eigenen Fähigkeiten und Köpfe investieren. Rückblickend scheint es fast absurd, dass die Bundeswehr in der Vergangenheit, um Kosten zu sparen, ihre Spionagesatelliten mit russischen Trägerraketen ins All gestartet hat – heute wäre das undenkbar. Aber auch heute ist es so, dass die Bundeswehr und auch europäische Institutionen ihre Satelliten fast ausschließlich mit SpaceX in den USA starten. Da kann man vielleicht ein paar Euro sparen, aber man entkoppelt sich dadurch auch von gewissen technologischen Entwicklungen. Vor allem stärkt man so nicht die eigenen Fähigkeiten und Unternehmen, aber darauf sollte der Schwerpunkt liegen.
Carsten Roemheld: Ich finde es sehr schön, dass Sie noch einmal auf die großen Pluspunkte auch hier in Deutschland hingewiesen haben – vor allen Dingen, was Forschung und Entwicklung angeht, was Bildung angeht, was universitäre Voraussetzungen angeht. Damit haben Sie noch einmal eine klare Lanze gebrochen, dass die Voraussetzungen hier in Deutschland sehr gut sind, dass nur die Rahmenbedingungen eben angepasst werden müssen. Dazu vielleicht noch eine Frage: Wie unterscheidet sich denn die deutsche, europäische New-Space-Szene von der US-amerikanischen, etwa bei Finanzierungsfragen, Innovationskraft und Regulatorik?
Matthias Wachter: Also die Finanzierung ist natürlich ein sehr großes Thema, und die Dinge hängen natürlich auch zusammen. In den USA fließt generell mehr privates Kapital in diesen Sektor, weil auch die amerikanische Regierung als Kunde mehr Aufträge an private Unternehmen vergibt und auch mehr investiert. Das heißt, da ist der Markt, der auch von der amerikanischen Regierung genutzt wird, deutlich größer als in Europa. Also zum Vergleich: Die USA geben jedes Jahr – wenn Sie das NASA-Budget nehmen, wenn Sie das Budget der Space Force nehmen und andere Budgets – im Bereich von 50 bis 60 Milliarden US-Dollar für Weltraumfähigkeiten aus. Und da erscheinen natürlich diese 35 Milliarden Euro, die Deutschland jetzt in den nächsten fünf Jahren – also jedes Jahr etwa sieben Milliarden Euro – investiert, schon wieder relativ klein. Und diese größeren amerikanischen staatlichen Investitionen und auch Bedarfe, die da dahinterliegen, treiben natürlich auch private Investitionen. Denn viele Unternehmen wollen natürlich an diesen Budgets partizipieren, Services bieten und Produkte herstellen. Und deshalb sind die Investitionen im privaten Bereich in den USA deutlich größer.
Was die Regulatorik angeht, würde ich sagen, dass wir gerade in Deutschland dieses dynamische Ökosystem haben im New-Space-Bereich, weil dieser bisher einer der wenigen Bereiche ist, der nicht überreguliert ist. Also ich würde es immer als eine Chance sehen, dass wir bisher kein nationales Weltraumgesetz haben und dass wir keine europäische Weltraumregulierung haben, weil das einfach Freiräume lässt, die dazu geführt haben, dass viele relativ einfach Unternehmen gründen konnten und einfach mal loslegen konnten. Und deshalb muss man, wenn man über das Thema Regulierung spricht, sehr behutsam vorgehen. Natürlich wird es perspektivisch die Notwendigkeit geben, gewisse Leitplanken einzuziehen, das ist vollkommen klar. Aber man muss das mit Bedacht machen, weil je stärker man reguliert, desto mehr Gefahr läuft man, dieses Ökosystem auch wieder abzuwürgen.
Carsten Roemheld: Sie haben vor allem bei der Finanzierungsfrage noch einmal klar auf die unterschiedliche Kraft der USA im Vergleich zu Europa und Deutschland hingewiesen. Mein Eindruck ist, auch wenn ich mit Kunden spreche, dass das Klima für Investitionen in diesem Bereich, auch vielleicht für private Raumfahrtunternehmen, sich deutlich verbessert hat in den letzten Jahren. Das hat sicherlich auch Gründe der Geopolitik und der Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Würden Sie es auch so einschätzen, dass sich die Möglichkeiten der Finanzierung, die Bereitschaft, das Investitionsklima allgemein verbessert haben in den letzten Jahren?
Matthias Wachter: In der Tat. Also das Investitionsklima hat sich hierzulande und in Europa, was die Bereitschaft angeht, in Space-Fähigkeiten und Unternehmen in diesem Bereich zu investieren, deutlich verbessert. Das hängt aus meiner Sicht unmittelbar auch mit dem Krieg gegen die Ukraine zusammen. Weil hier natürlich über Nacht deutlich geworden ist, wie wichtig Weltraumfähigkeiten sind. Und wenn man sich das genau anschaut, dann ist es ja auch so, dass dieser Krieg im Weltall begann, weil nämlich wenige Stunden vor der russischen Bodenoffensive 2022 Russland einen Cyberangriff auf eine Satellitenkonstellation durchgeführt hat, die von der Ukraine genutzt wurde. Das hat dazu geführt, dass in weiten Teilen des Landes die Internetverbindung und damit auch die Kommunikationsfähigkeit der Regierung mit den Streitkräften ausgefallen ist. Und die Kommunikationsfähigkeit wurde erst wiederhergestellt, als dann Elon Musk eingesprungen ist und der Ukraine Starlink zur Verfügung gestellt hat und das über der Ukraine freigeschaltet hat. Und das war, glaube ich, so ein Wake-up-Call, wo viele dann gesagt haben: Das ist jetzt wirklich kein Orchideenthema mehr, sondern da geht es um etwas. Und deshalb sind die Investitionen in dem Bereich gestiegen.
Wenn man sich das deutsche Ökosystem anschaut, ist es vielen jungen Unternehmen gelungen, in den letzten Jahren zum Teil Hunderte von Millionen Euro an Venture Capital zu beschaffen. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir in so eine Growth-Phase kommen und wo die Ticketgrößen einfach noch einmal größer werden müssen, weil gewisse Dinge zu realisieren einfach Geld kostet. Und da sind wir gerade an so einem Punkt, wo sich, glaube ich, entscheiden wird, ob es gelingt, dass noch mehr privates Geld hier reinfließt, damit viele der Pläne, die private Unternehmen haben, dann tatsächlich realisiert werden können.
Carsten Roemheld: In welchen Bereichen sehen Sie denn die größten Chancen für die europäischen und die deutschen New-Space-Unternehmen?
Matthias Wachter: Wenn wir uns die Space Economy heute anschauen, dann ist sie im Wesentlichen schon ein Data Business. Zwei Drittel der Umsätze sind Anwendungen, sind sogenannte Downstream Services. Und ich glaube, dieser Bereich, der wird in Zukunft noch wichtiger werden. Und er wird vor allem für ein Land wie Deutschland, das sehr industrielastig ist, mit einer produzierenden Industrie, noch wichtiger werden, weil es eine zunehmende Verzahnung und Vernetzung von Space und Non-Space gibt. Viele Anwendungen und Produkte werden auf der Erde in Zukunft nur noch funktionieren, wenn sie Daten und Anbindungen ans All haben. Also das, glaube ich, ist ein ganz, ganz großer Markt. Und der wird natürlich auch dazu führen, dass es mehr Raketenstarts und Satelliten braucht. Das sind dann sozusagen die Dinge, die das möglich machen. Das sehe ich als ein großes Segment.
Und ich sehe perspektivisch auch die Rückkehr der Menschheit zum Mond als ein sehr großes Wachstumsfeld. Als wir das letzte Mal auf dem Mond waren, da ging es ja primär darum, im Systemwettbewerb zu zeigen: Wer kann es, wer ist besser und wer rammt als Erster seine Fahne ein? Und nachdem das passiert ist, ist der Mond so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber das ändert sich jetzt. Wir sind längst in einem neuen Space Race zwischen den USA und China. Es geht um die Rückkehr zum Mond, und diesmal um eine dauerhafte Präsenz, weil der Mond ein Sprungbrett ist für weitere Sprünge ins Sonnensystem. Und weil der Mond einfach auch strategisch wichtig ist. Er ist, was wir wissen, sehr rohstoffreich. Sie haben am Südpol Wasservorkommen in Form von Eis und anderen Dingen im Regolith gefroren. Das heißt, Sie können damit Treibstoff bauen, Sie können produzieren, Sie können eine Basis aufbauen und betreiben, Sie können dann in der Folge weitere Rohstoffe fördern. Wir hatten bei uns im Weltraumkongress Unternehmen, die zum Beispiel Interesse daran haben, Helium-3 zu fördern. Das kommt auf dem Mond in einer deutlich größeren Konzentration vor als auf der Erde. Und Helium-3 könnte ein elementarer Treibstoff für zukünftige Fusionskraftwerke werden. Da entstehen ganz neue Möglichkeiten und Perspektiven, jenseits von: Wir rammen die Fahne ein und haben gezeigt, dass wir es können. Und ich glaube, das wird perspektivisch auch für die deutsche Industrie eine sehr große Chance sein. Weil, wenn ich dahin fliege und eine Basis aufbaue, dann brauche ich gewisse Fähigkeiten. Ich werde es erstmal vielleicht robotisch aufbauen. Deutschland ist sehr stark im Bereich Robotik, im Bereich Automotive, im Bereich Industrialisierung. Wir reden perspektivisch über Rohstoffförderung auf dem Mond. Und da kommen dann Bedarfe zutage, wo gerade die deutsche Industrie große Stärken hat, Maschinen- und Anlagenbau zum Beispiel. Und das sehe ich perspektivisch – nicht morgen, aber übermorgen – als ein weiteres großes Betätigungsfeld und eine sehr große Chance.
Carsten Roemheld: Vielleicht spielt ja dann auch der Mars eine Rolle, wie Elon Musk es, glaube ich, gerne hätte. Aber lassen Sie uns zu dem anderen Punkt kommen. Wir haben gerade über das Sonnensystem, über das Weltall gesprochen, was ja sehr groß ist. Andererseits ist die Umlaufbahn der Erde jetzt nicht so groß, und da sind eine ganze Menge Satelliten unterwegs, 13.000 Stück aktuell. Elon Musk hat allein für sein Starlink-Netzwerk noch weitere 30.000 Satelliten geplant. Und China hat auch von 15.000 geplanten Satelliten gesprochen, die ins All geschossen werden sollen. Ist da oben überhaupt genug Platz, dass sich so viele Satelliten dort bewegen können?
Matthias Wachter: Es wird in der Tat zunehmend eng. Und es wird zu einer immer größeren Herausforderung, aus zwei Gründen: Zum einen haben Sie immer mehr alte Satelliten, die nicht mehr im Betrieb sind, dort rumfliegen. Durch diesen Weltraumschrott steigt die Gefahr von Kollisionen. Und dann gibt es den Kessler-Effekt. Dann entstehen tausende kleinere Absplitterungen, die sich immer weiter vervielfältigen. Damit könnten ganze Orbits nicht mehr genutzt werden, weil sie vermüllt sind. Das ist ein großes, ernstes Thema, auf das die Menschheit insgesamt eine Antwort finden muss, wie wir damit gemeinsam umgehen. Und auf der anderen Seite wird es natürlich für Satellitenkonstellationen immer entscheidender, die „guten“ Orbits abzubekommen. Ich will heutzutage immer näher an der Erdoberfläche sein, weil damit die Latenzzeiten – also die Zeiten des Datenaustausches – reduziert werden. Ich will immer mehr Satelliten haben, und es führt natürlich auch zu einer Art Wettstreit um die entsprechenden Positionen im All, im Low Earth Orbit. Es gibt in Genf eine Behörde, die ITU, die die Frequenzen für Satelliten vergibt. Das tut sie nach dem Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Und es ist so, dass sich viele Akteure sich heute schon viele gute Frequenzen gesichert haben und dadurch ihre Konstellationen aufbauen. Dadurch wird es immer enger, und die Gefahr von dominierenden Playern nimmt eher zu als ab.
Carsten Roemheld: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es dort zu einer Art Massenkarambolage kommen kann, in deren Rahmen dann vielleicht einige Satelliten ausfallen und Probleme auf der Erde verursachen könnten?
Matthias Wachter: Also die Gefahr steigt von Tag zu Tag. Wir wissen von sehr vielen Unternehmen, dass der Aufwand, Ausweichmanöver zu fliegen, um solche Kollisionen zu vermeiden, immer größer wird. Große Konstellationsbetreiber haben zum Teil Leute und Stäbe, die nichts anderes machen, als permanent die Flugbahnen zu berechnen und zu gucken: Wie fliegen andere Objekte? Besteht da die Gefahr einer Kollision? Und dann gibt es eher so hemdsärmelige Prozesse, so würde ich das mal nennen, dass man dann den anderen Konstellationsbetreiber anruft und sagt: Hey, du musst da jetzt wegfliegen, sonst kollidieren unsere Satelliten. Das funktioniert bisher ganz gut – oder mehr schlecht als recht, würde ich sagen. Aber es wird natürlich immer schwieriger. Und die Gefahr einer größeren Karambolage, so wie Sie das beschrieben haben, die steigt. Und wenn es einmal zu einer größeren Kollision kommt und dann zu Absplitterungen mit immer mehr werdenden Teilen, dann kann sich das natürlich immer weiter fortsetzen und größer werden. Das ist ein echtes Problem.
Carsten Roemheld: Gibt es denn eine Möglichkeit, Weltraumschrott irgendwie umzuleiten oder besondere Wege für diesen Schrott zu bestimmen, damit er Teilen, die wichtig sind, nicht in den Weg kommt?
Matthias Wachter: Das übliche Verfahren ist, dass die Satelliten – vor allem die Satelliten im Low Earth Orbit, die also sehr nahe an der Erdoberfläche sind – mittlerweile so designt sind, dass sie sich am Ende ihrer Lebenszeit nach drei, vier, maximal fünf Jahren automatisch absenken. Sie haben dann noch so viel Resttreibstoff, dass sie tiefer gehen können und damit in die Erdanziehungskraft reinkommen. So verglühen sie dann in der Erdatmosphäre und werden nicht zu Schrott. Das gibt es, das findet statt, und vor allem westliche Konstellationsbetreiber machen das. Das ist auch eine Auflage, die zum Beispiel von Versicherungen und auch vom Finanzmarkt her immer stärker eingefordert wird, Stichwort Nachhaltigkeit. Aber es gibt eben keine generelle Regelung. Und es gibt Akteure, die dem natürlich nicht unterliegen. Und es ist natürlich im Moment so, dass es eher noch günstiger ist, wenn ich auf so etwas verzichte, als wenn ich so eine Einrichtung mit vorsehe oder zum Beispiel ein Sonnensegel habe, das dann ausgeklappt wird und dazu führt, dass der Satellit in der Erdatmosphäre verglüht. Man kann sagen, es gibt technische Lösungen. Sie kommen immer mehr zum Einsatz, weil das Problem erkannt ist, vor allem bei westlichen Systemen und Konstellationen. Aber die Grundproblematik bleibt natürlich. Und solange nicht alle entsprechend verantwortungsvoll handeln, bleiben die Risiken natürlich hoch.
Carsten Roemheld: Genau dazu vielleicht die Abschlussfrage unseres Gesprächs: Wir haben auf der Erde versucht, nachhaltige Kriterien einzuführen. Im All, haben wir gerade gesehen, kann auch ein gewisses Umweltchaos eintreten. Gibt es denn die Absicht, internationale Regeln oder Abkommen, Regulierungen irgendwie einzurichten, um den Weltraum ein bisschen nachhaltiger nutzbar zu machen? Oder glauben Sie, dass das aufgrund der jeweiligen nationalen Interessen nicht passieren wird?
Matthias Wachter: Die geopolitischen Entwicklungen auf der Erde erschweren zunehmend eine Verständigung, was die gemeinsame Nutzung des Alls angeht. Das ist extrem bedauerlich. Es gibt heute schon gewisse Grundprinzipien: Es gibt einen Weltraumvertrag, den sogenannten Outer-Space-Treaty aus dem Jahr 1967, der auf UN-Ebene gewisse Spielregeln im All regelt. Also man will keine Militarisierung des Alls, die Verbringung von zum Beispiel Atomwaffen ins All ist untersagt, und es ist auch geregelt, dass die Nationalstaaten einen gleichberechtigten Zugang zum All haben sollten. Das ist ein Gemeingut der Menschheit, so wird es beschrieben. Aber im Jahr 1967 waren eben gewisse Entwicklungen, wie sie heute stattfinden, noch nicht absehbar. Also die Kommerzialisierung, das Verbringen von Tausenden, Abertausenden Satelliten in den Low Earth Orbit, das war damals natürlich noch kein Thema.
Auch so Fragen, die perspektivisch kommen: Was ist mit der Förderung von Rohstoffen im All? Kann ich einfach zu einem Asteroiden hinfliegen und ihn abbauen? Und wem gehört das? Muss das irgendwie geregelt werden? Da gibt es ganz, ganz viele offene Fragen und Punkte. Am sinnvollsten wäre aus meiner Sicht, wenn man sich international verständigen würde und diesen Outer-Space-Treaty weiterentwickeln würde, an das New-Space-Zeitalter anpassen würde. Aber im Moment sieht es leider nicht danach aus, weil natürlich jeder um seinen Vorteil bedacht ist und diesen nicht verspielen will. Ich glaube, da ist weitere Überzeugungsarbeit notwendig. Da ist Diplomatie gefordert, internationale Zusammenarbeit, damit dieser Zugang und die Nutzung des Alls, die so wichtig ist für uns als Menschheit, als Gesellschaft, erhalten bleibt und auch in Zukunft weiter möglich ist.
Carsten Roemheld: Dann wollen wir dabei auf jeden Fall optimistisch bleiben. Ich danke Ihnen vielmals für dieses Abschlusswort. Ich glaube, heute war es extrem spannend, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, zu sehen, welche Möglichkeiten mit dem Weltall verbunden sind, welche Wichtigkeiten damit verbunden sind, wie technologische Förderung und Innovation im Weltall weitergeht. Die Tatsache, dass wir hier in Europa zumindest erkannt haben, dass wir investieren müssen, dass wir große Summen in die Hand nehmen, um zumindest mal ein bisschen weiter in den Wettbewerb zu treten gegenüber den USA. Und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Und noch einmal betonend, dass hier in Deutschland gerade auch sehr innovative Kräfte da sind, dass das Investitionsklima sich verbessert. Insofern nehmen wir einige sehr optimistische Dinge hier aus diesem Gespräch mit. Ich danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch, Herr Wachter.
Matthias Wachter: Herzlichen Dank.
Carsten Roemheld: Herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Ich glaube, heute war es sehr, sehr spannend, und Sie konnten sicherlich wieder ein paar Gedanken mitnehmen und ein paar Ideen, die hier heute neu waren. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bei einer der nächsten Ausgaben oder bei einem der vielen anderen Fidelity-Formate wiedersehen würden.
Herzliche Grüße
Ihr Carsten Roemheld